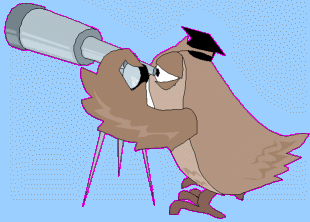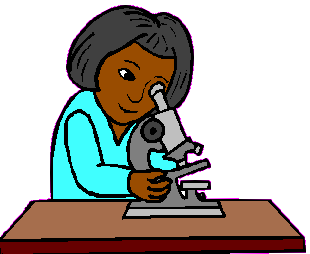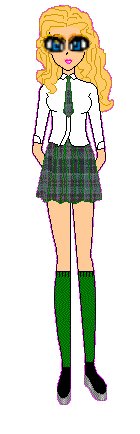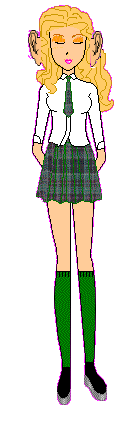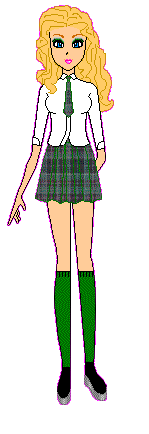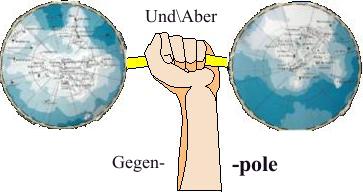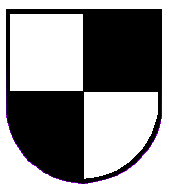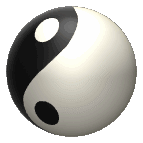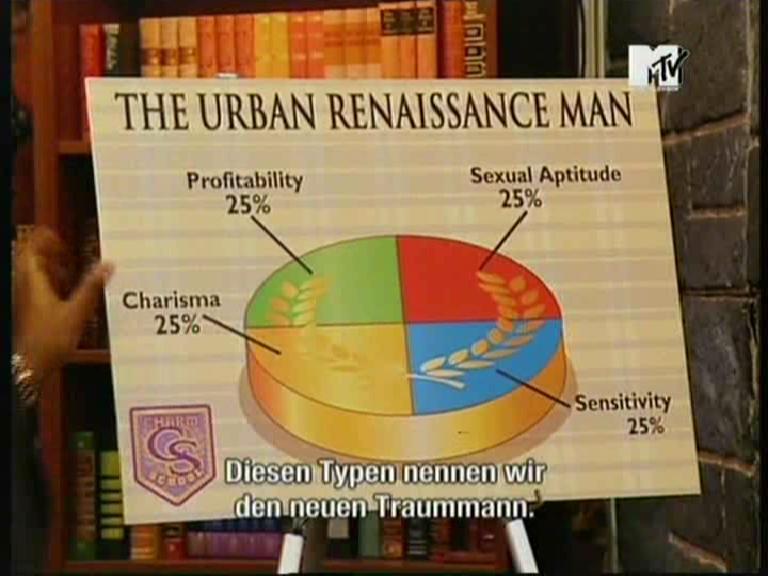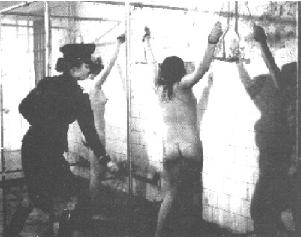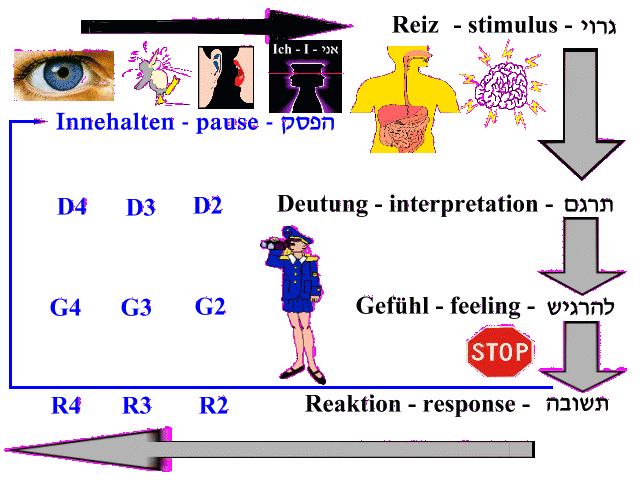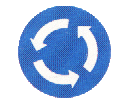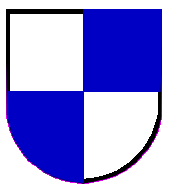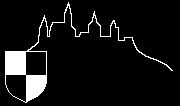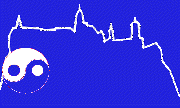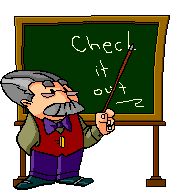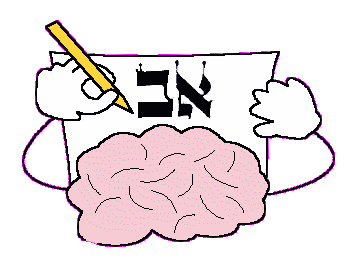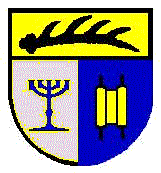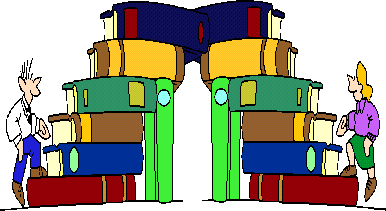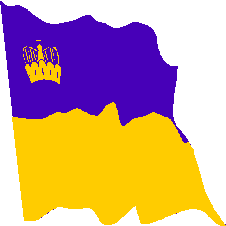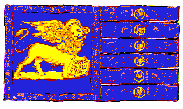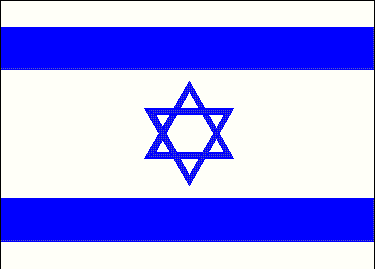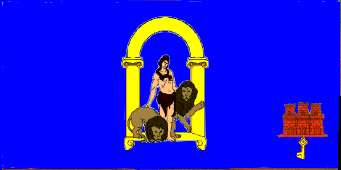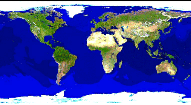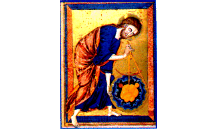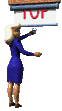Charaktere 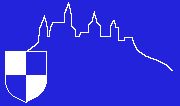 zumindest Charakteristisches
zumindest Charakteristisches
|
[So
bedrohlich, äh vereinheitlicht,
erscheinen der Vielfalten Vielzahlen sonst kaum (wem / wo)] |
.auffällig gerne
ein- und zugeteilt, sowie nicht selten für sich
selbst beansprucht, bis befüchtet oder (wider bis für einen selbst /\ andere)
reserviert. Die vier antiken,
‚griechischen‘ Klassiker ( |
Hinter, oder wenigstens in,
den Mauern des Innenhofs,
auch deren Bildung, / Entstehung - zwar nicht
weit von der Widerspruchbastei
gar der (Er-)Neuerung entfernt, etwas höher auf den
Felsen, und noch unmittelbarer gleich unter ‚den Vernunften‘ (des Verstehens) gelegen;
doch/also allenfalls (zumal
[durch/von sich qualial] selbst) bedingt einsehbar
- sind/werden hier,
vielleicht sogar Euer Gnaden / Ihre, Eingeschaften aufgebaut,
bis persönlich betretbar, äh beispielhaft, vertreten. |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eigenschaften,
gar (in
welchen Ausdruckssinnen auch immer) ‚menschliche‘,
erweisen sich einem, bis sind gar empirisch, so vielfältig, dass dies, und/oder jedenfalls manche davon, einem
– eben trotz, selbst begrifflicher
Einteilungs- und Bündelungs- bzw. Erklärungsschemata
derselben – von unwiderstehlich, bis unerträglich, namentlich zu
reich/arm an Ähnlichkeiten und/oder
Verschiedenheit zum/mit dem Eigenen/Gewollten erscheinen, bis sind. |
Im
Hochschloss der |
|
|
Recht simpel, also besonders wirkmächtig, unterscheiden
sich/einander Menschen hinsichtlich der Art/en und Weise/en, die s/Sie als angenehm, bis
eben immerhin selbstverständlich
vertraut, erleben,
überhaupt etwas bzw. jemanden respektive ‚alles'‘ in
Erfahrung und/oder zum Ausdruck zu bringen. |
Erstaunlich vereinfacht, (also
quasi idealtypisch) lassen sich beispielsweise dreierlei Wahrnehmungs-Wege in's/zum
Erinnerungsvermögren von Menschen unterscheiden,
deren persönliche, und/oder/aber situative,
Mischungsverhältnisse untereinander, etwa darüber (mit)entscheiden: Ob jemand 'die
Dine und Ereignisse bzw. Personen' besser durch Sehen, besser durch Hören
oder besser durch haptisches nach- bzw. mitvollziehendes 'Ausprobieren' erfahren, bis verstehen,
kann/würde. |
|
|
Die
Folgen sind ja nicht selten ganz erheblich -
dafür eher selten umfänglich bemerkt,
oder gar personengerecht (sondern meist eher anklagend/beschuldigend) erklärt. Verständigungs-
bis Verfeindungseffeclte, die mit/an/in vielen,
wechselseitig komplementären respektive unpassenden, Basalitäten
auftreten. |
Eine – auch nach der
immerhin Überwindung dichotomer Zweiteilung, gar in ‚eigen
und fremd‘ bzw. gleich ‚Fresund
oder Feind‘, leider - eher sogar noch weniger bekannte, wichtige
Dreierteilung, legt George
Pennington für die / der, hier ja gleich benachbarten, menschenheitlichen
‚Beweggründe, bis
sogar eher Triebkräfte‘, vor.
„Der Einfachheit
halber kürze“
er „die drei pnmären Motivatoren [sic! gar als ‚Charakterzüge‘
verstehbar, bis gemeint; O.G.J.] im Folgenden ab. I steht für Interesse
bzw. intellektuelle Begabung, F für Freude bzw. soziale
Begabung und L für Lust/Wohlsein bzw. sinnlich/sensorisch/handwerkliche Begabung.“
Alles ‚Talente‘ bis (gar Kant-ups)
‚Neigungen‘ bzw. ‚Ideocharismen/Intelligenzarten‘, die von wesentlicherer Bedeutung, als (zumal externe) Anzeize und
Motivatopnsmaßmamems seien – insoweit G.P.
auch mit anderen Autoren wie hier etwa M.v.M.
und R.K.S..
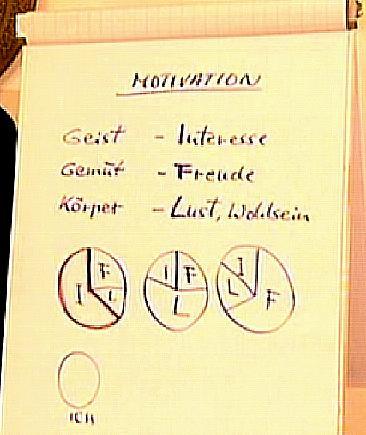 [Mit Reverenz
an das wichtige Werk und Wirken Sir
Georges. – Mental(-denkerisch)e
Landkarte basaler Motivationsarten:
‚Interessenverfolgung‘ gilt
manchen als verwerflich, obwohl, bis weil, gerade in/an dem Denkkonzept, zumal
‚recht‘/hinreichend umfänglich verstandener
(Interessenlagen), die Beschäftigung mit einem ambivalenten, bis unangenehmen,
Notwendigkeiten – jedenfalls dafür Gehaltenem, (auch geradezu ‚materiell‘) empirisch
gesetzt]
[Mit Reverenz
an das wichtige Werk und Wirken Sir
Georges. – Mental(-denkerisch)e
Landkarte basaler Motivationsarten:
‚Interessenverfolgung‘ gilt
manchen als verwerflich, obwohl, bis weil, gerade in/an dem Denkkonzept, zumal
‚recht‘/hinreichend umfänglich verstandener
(Interessenlagen), die Beschäftigung mit einem ambivalenten, bis unangenehmen,
Notwendigkeiten – jedenfalls dafür Gehaltenem, (auch geradezu ‚materiell‘) empirisch
gesetzt] 
Interesse daran bzw. an jemandem – wo der bzw. Ihr ‚Geist‘/Denken
angesprochen/aktiv sei
(reichen die
Treppentürme des EMuN/aH-Gebäudes-אמון׀אמונה drüben bis herunter in/auf diese Tiefe) – „da gibt es kein Halten“
(G.P.).
 [Heftig,
dass es sich nicht einmal um wohlverstandene/‚die richtigen‘, und gleich gar nicht
immer um ‚gute‘, moralische, sittlich
anerkannte etc., Interessiertheiten
handeln muss – sowie
zumeist auch gegenteilige vorfindlich – mindestens auch solche
‚sozialer/soziologischer Arten‘ und der
‚Weisen möglichen Wohlbefindens‘]
[Heftig,
dass es sich nicht einmal um wohlverstandene/‚die richtigen‘, und gleich gar nicht
immer um ‚gute‘, moralische, sittlich
anerkannte etc., Interessiertheiten
handeln muss – sowie
zumeist auch gegenteilige vorfindlich – mindestens auch solche
‚sozialer/soziologischer Arten‘ und der
‚Weisen möglichen Wohlbefindens‘] 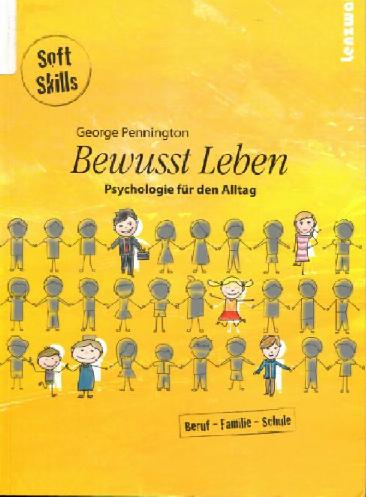
„Als Kinder lesen sie lieber
ein Buch (I-typisch) als mit anderen Kindern zu spielen (F). Wenn sie
eine praktische [sic! etwa ‚haptische‘;
O.G.J.] Begabung mitbringen
(L) sind sie imstande, das Telefon auseinander zu nehmen, um nachzusehen, was
drin ist. In der Schule haben diese Kinder keine Probleme. Ihr Gehirn [sic!] ist gut [sic! andere Leute/Denkorgane sind
keineswegs ‚schlechter‘; O.G.J. zwar durchaus mit G.P.‘s Wertschätzungsabsicht,
doch weniger naturalistisch bis deterministisch]
organisiert und sie sind
leidenschaftlich am Lernen interessiert.
In ihrem späteren [sic!] Leben
ergreifen sie wahrscheinlich einen Beruf, der ihren speziellen Interessen
entspricht. Manche stellen ihr ganzes Leben in den Dienst eines speziellen
Interesses: Medizin, Astrophysik, Umweltschutz, Geologie, Archäologie
...
In meinem Beispiel habe ich den L-Teil
recht [grüß] gezeichnet. Das wäre typisch für den Professor, der so
tief in Gedanken oder im Gespräch ist, dass er vergist
zu essen, bevor die Kantine schließt. Wäre der F-Teil noch kleiner, dann könnte
er ein Eigenbrötler sein, ein Schreiber gelehrter Bücher vielleicht, aber nicht
[sic!] sehr
interessiert an Gesellschaft. 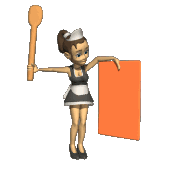 [Intellektuelle, in diesem engeren Sinne, sind
nicht notwendigerweise gemeinwesnetlich uninterressiert, eher gesellschaftlich randständige AußenseiterInnen, zumal des/gegenüber dem Sozialleben/s –
gerade ihre eigenen Stellungen/Interessenlagen
durchaus (teils
wesentlich/zu einseitig) verkennend]
[Intellektuelle, in diesem engeren Sinne, sind
nicht notwendigerweise gemeinwesnetlich uninterressiert, eher gesellschaftlich randständige AußenseiterInnen, zumal des/gegenüber dem Sozialleben/s –
gerade ihre eigenen Stellungen/Interessenlagen
durchaus (teils
wesentlich/zu einseitig) verkennend]
Nicht alle
I-Typen funktionieren auf dieselbe Art. Visuelle
Denker denken in
Bildern.
Sie können ausgezeichnete Analysten oder Planer sein, aber schlecht
in Algebra. Andere denken in Mustern. Sie können
wiederkehrende Muster in
der
Musik, der Mathematik oder in der Natur erkennen, die anderen brillanten
Köpfen [sic!]
völlig entgehen. Andere wiederum denken in Worten
und Sätzen. Sie formulieren
brillant, sind aber nicht sonderlich gut darin etwas
zu visualisieren. Jede Art hat
ihre Besonderheiten und Schwächen, je nach ihrer zerebralen Spezialisierung.
Eltern sollten sich auf die besonderen Begabungen ihrer Kinder konzentrieren
und sich keine
[sic! das Hinzulehren am/von Fähigkeiten, muss nicht einmal hier völlig
unmöglich sein/werden; O.G.J. durchaus gegen ‚übertreibende Übertreihungen (gleich gar elterlicher Maßmahmen)‘ und überzeugt,
dass ‚Bewustheiten
für/vom Anderheiten‘ sowie
Stärkenförderung / Schwächenakzeptanz (statt: deren
Ignoranz / alleskönnender Übermenschen)
schon viel hülfen] Sorgen
machen um die Dinge, die sie nicht so gut können. [Insbesondere
hinsichtlich sogenannten ‚Mängeln‘ in sozialer und/oder
sensorischer Kompetenz, bis Intelligenz bleibt
hinzu-Lernen (dagegen) durchaus wichtig, bis möglich; O.G.J. insbesondere ‚innere
Schweinehunde‘-freundlich – zumal was potenzielle Charakterschwächen,
bis Kooperationshemmnisse und Handikaps, anginge] ![]() [Pädagogik und Nymphagogik
gehen davon aus, dass (gar charakterliche) Eigenschaften gebildet, jedenfalls
entwickelt, werden können; auch Andragogik/Erwachsenenbildung
hat nicht alle Gewohnheitenänderungen
ausgeschlossen]
[Pädagogik und Nymphagogik
gehen davon aus, dass (gar charakterliche) Eigenschaften gebildet, jedenfalls
entwickelt, werden können; auch Andragogik/Erwachsenenbildung
hat nicht alle Gewohnheitenänderungen
ausgeschlossen] 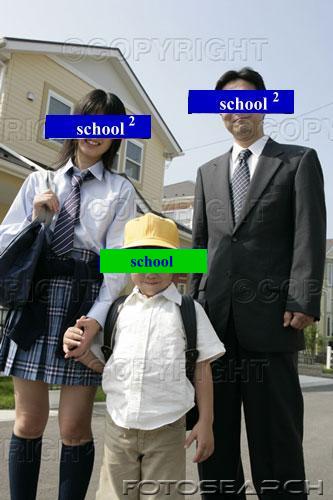
Je
nach ihrer speziellen Begabung sind I-Typen
gute Analysten, Theoretiker,
Planer, Strategen,
Denker, Spezialisten, Forscher, Erfinder
und Entwickler. Sie passen gut in jeden [sic!] wissenschaftlichen
oder unternehmerischen Beruf, der
Verwendung für Ihre Talente
hat.
Gelegentlich
finden wir einen verirrten I-Typen, einen hoch qualifizierten, intellektuellen Spezialisten, der die
Personalverantwortung für eine große Abteilung hat. Als er anfing war seine
Leistung  [sic! ein weltanschaulich
widersprüchlich sehr hoch aufgeladener Begriff;
O.G.J. eher ‚Aufgabenerfüllungs‘- bis ‚Arbeits‘-Ausdrücken
orientiert] so herausragend, dass
er befördert und befördert wurde, bis er die Ebene seiner Inkompetenz
erreichte'', auf der er dann blieb. Eine Führungsposition braucht eine [gar
zudem hinreichend ‚sensorische‘] Sozialbegabung, die nicht jeder I-Typ in
ausreichendem Maße mitbringt. Zum Glück ist das Problem inzwischen den meisten
Unternehmen bewusst. Viele bieten
Karrieren an, die nicht unbedingt Personalverantwortung mit sich bringen
(Linienkarriere/Fachkariere). Viele Personalabteilungen unterstützen jetzt die
interne Job-Mobilität um sicherzustellen [sic!], dass alle ihren bevorzugten Arbeitsplatz
finden.“ (G.P. S. 66; verlinkende
Hervorhebungen O.G.J.)
[sic! ein weltanschaulich
widersprüchlich sehr hoch aufgeladener Begriff;
O.G.J. eher ‚Aufgabenerfüllungs‘- bis ‚Arbeits‘-Ausdrücken
orientiert] so herausragend, dass
er befördert und befördert wurde, bis er die Ebene seiner Inkompetenz
erreichte'', auf der er dann blieb. Eine Führungsposition braucht eine [gar
zudem hinreichend ‚sensorische‘] Sozialbegabung, die nicht jeder I-Typ in
ausreichendem Maße mitbringt. Zum Glück ist das Problem inzwischen den meisten
Unternehmen bewusst. Viele bieten
Karrieren an, die nicht unbedingt Personalverantwortung mit sich bringen
(Linienkarriere/Fachkariere). Viele Personalabteilungen unterstützen jetzt die
interne Job-Mobilität um sicherzustellen [sic!], dass alle ihren bevorzugten Arbeitsplatz
finden.“ (G.P. S. 66; verlinkende
Hervorhebungen O.G.J.)
[Sozialrespektsdistanz immerhin ‚innerlich‘/zumal sich selbst gegenüber
(also bis ‚sozialwesentliche‘)
vorausgesetzt]  Und/Oder
mit/in Freude an oder über jemandem, respektive etwas – wo das/Ihr (zumindest begrifflich ja bereits weitgehend vergessenes/verdrängtes) Gemüt erlaubt ist/wird (reicht/geht diese
Und/Oder
mit/in Freude an oder über jemandem, respektive etwas – wo das/Ihr (zumindest begrifflich ja bereits weitgehend vergessenes/verdrängtes) Gemüt erlaubt ist/wird (reicht/geht diese 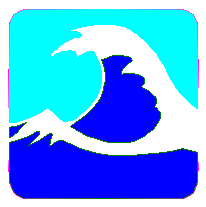 [Welle-ג – zumal des Mitgefühls / Erbarmens גימל /gimel/ bekanntlich zugleich Eigenname dieses dritten
der Zeichen] zumindest bis in die Höhen
auch benachbarter ‚Dachstühle‘
drüben des Seins hinauf) sind ebenfalls unerschöpfliche, also durchaus ‚reine‘, Quellen
erschlossen.
[Welle-ג – zumal des Mitgefühls / Erbarmens גימל /gimel/ bekanntlich zugleich Eigenname dieses dritten
der Zeichen] zumindest bis in die Höhen
auch benachbarter ‚Dachstühle‘
drüben des Seins hinauf) sind ebenfalls unerschöpfliche, also durchaus ‚reine‘, Quellen
erschlossen. 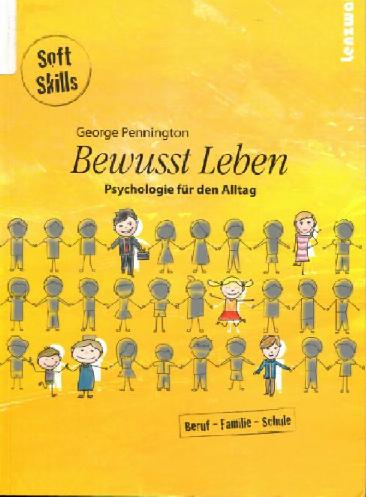 „Diese Leute haben die Begabung Andere
glücklich
zu machen. Als Kinder werden sie eher am Telefon oder in einem
Internet-Chat die nächste Party oder einen Kinobesuch mit Freunden
organisieren, als ein Buch zu lesen. Sie gehen gerne in die Schule, nicht so
sehr zum Lernen, mehr wegen der Gesellschaft, die sie dort
finden. Lehrer erkennen ihre soziale Begabung nur selten
als ein besonderes Talent. Auch Eltern können
sich damit schwer tun sie zu erkennen [sic!] und wertzuschätzen, speziell
wenn sie selber keine sonderliche Sozialbegabung haben. Da sie in
herkömmlichen Schulfächern oft nicht so gut sind, werden sozialbegabte Kinder oft als Versager gebrandmarkt. Der Schaden, den die Schule
[sic!] hier anrichten kann,
ist immens.
„Diese Leute haben die Begabung Andere
glücklich
zu machen. Als Kinder werden sie eher am Telefon oder in einem
Internet-Chat die nächste Party oder einen Kinobesuch mit Freunden
organisieren, als ein Buch zu lesen. Sie gehen gerne in die Schule, nicht so
sehr zum Lernen, mehr wegen der Gesellschaft, die sie dort
finden. Lehrer erkennen ihre soziale Begabung nur selten
als ein besonderes Talent. Auch Eltern können
sich damit schwer tun sie zu erkennen [sic!] und wertzuschätzen, speziell
wenn sie selber keine sonderliche Sozialbegabung haben. Da sie in
herkömmlichen Schulfächern oft nicht so gut sind, werden sozialbegabte Kinder oft als Versager gebrandmarkt. Der Schaden, den die Schule
[sic!] hier anrichten kann,
ist immens.
Für sozialbegabte eignet sich jede Beschäftigung,
die sie in einen
relevanten Kontakt mit anderen Menschen
bringt: Gastronomie, Gesundheits- und Sozialberufe, Unterricht. Sie sind gute
Ein- und Verkäufer und für Führungsaufgaben deutlich besser geeignet als der
I-Typ. Und für die Kundenbetreuung.“ ( G.P. S. 66; verlinkende Hervorhebungen O.G.J.) 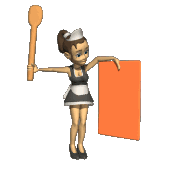 [Na klar,
sind alle drei Kategorien Interesse/n sowohl an manchen denkerischen Repräsentationen
‚wie‘/und an damit Gemeintem / Repräsentiertem
selber/st]
[Na klar,
sind alle drei Kategorien Interesse/n sowohl an manchen denkerischen Repräsentationen
‚wie‘/und an damit Gemeintem / Repräsentiertem
selber/st]  Zwar, bis zurecht / zutreffend,
charakterisieren uns / mich manche, ja viele, als asozial / ungesellig.
Zwar, bis zurecht / zutreffend,
charakterisieren uns / mich manche, ja viele, als asozial / ungesellig. Weder Alles essend, noch servieren lassend, oder
gar beanstanden müssend, was vielleicht ‚gut schmeckt‘, bis Sie wollen.
Weder Alles essend, noch servieren lassend, oder
gar beanstanden müssend, was vielleicht ‚gut schmeckt‘, bis Sie wollen.
[Tischgemeinschaften
–gleich gar über dyadische Zweisamkeiten
hinausgehende, wären / waren uns
dennoch manche genehm]
Zumal Essensgemeinschaften
mit / von Leuten, die einander, denen ich / wir, widerspreche/n, sind/werden
nicht notwendigerweise
(wünschenwerte)
‚Besprechungen‘, oder gar Einigung, bis Einheiten
– gleich gar nicht in Ernährungsfragen / Wirtschaftsweisen.
 Bereits
hinübersehend – wenn vielleicht
auch noch nicht drüben ‚auf der Giudecca‘,
eingedeckt. [Immerhin venezianische Dachterrasse, gar noch vakant aussehenden,
Festbanketts]
Bereits
hinübersehend – wenn vielleicht
auch noch nicht drüben ‚auf der Giudecca‘,
eingedeckt. [Immerhin venezianische Dachterrasse, gar noch vakant aussehenden,
Festbanketts]
[Soziokulturelle
Limitationen von Naturtrieben (und dagegen, äh dafür, Gehaltenem) korrelieren durchaus eher mit deren
gezielter Verstärkung, als mit ihrer vorgeblich
beherrschenden Eindämmung(sbedürftigkeit)]
 Falls,
wo und insoweit gar / eben Lust, oder immerhin (mehr) Wohlsein, Ihren äh
den / die Körper beachtet / befragt, statt (etwa als nur / da ‚bedürftig‘, ‚störend‘,
‚vergänglich‘, ‚materiell‘) verachtet,
wird – sogar ein / Ihr ‘point of balance‘ zugänglich / betroffen.
Falls,
wo und insoweit gar / eben Lust, oder immerhin (mehr) Wohlsein, Ihren äh
den / die Körper beachtet / befragt, statt (etwa als nur / da ‚bedürftig‘, ‚störend‘,
‚vergänglich‘, ‚materiell‘) verachtet,
wird – sogar ein / Ihr ‘point of balance‘ zugänglich / betroffen.
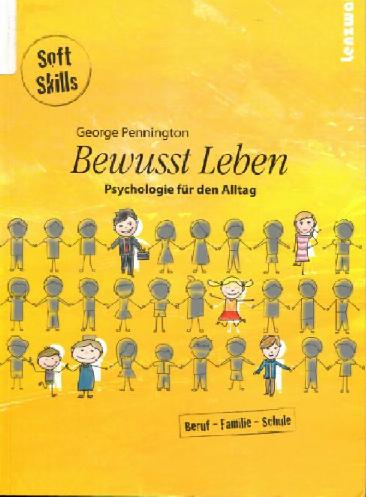 „ Das [Lust haben, bis Wohlbefimdem] bezieht sich nicht nur auf das körperliche Wohlsein. Es
schließt auch alles
„ Das [Lust haben, bis Wohlbefimdem] bezieht sich nicht nur auf das körperliche Wohlsein. Es
schließt auch alles ![]() ästhetische
mit ein. Diese Leute wissen einfach [sic! empfinden
gar eher ‚gewissenhaft differenziert‘ statt notwendigerweise konsensual, korrekt und
gleich gar nicht immer sofort; O.G.J., gar mit E.B., ‚Gefühle‘ zudem eher für eine
Unterkategorie an/der
Sich-/Anderes-Empfindungen haltend],
ästhetische
mit ein. Diese Leute wissen einfach [sic! empfinden
gar eher ‚gewissenhaft differenziert‘ statt notwendigerweise konsensual, korrekt und
gleich gar nicht immer sofort; O.G.J., gar mit E.B., ‚Gefühle‘ zudem eher für eine
Unterkategorie an/der
Sich-/Anderes-Empfindungen haltend], ![]() wie die Dinge sein sollten. Sie können selten erklären, warum, sie haben
einfach [sic! durchaus
trainier-
א־מ־ן und zivilisierbares Talent; O.G.J.] dieses Gefühl [sic? Empfinden
wie die Dinge sein sollten. Sie können selten erklären, warum, sie haben
einfach [sic! durchaus
trainier-
א־מ־ן und zivilisierbares Talent; O.G.J.] dieses Gefühl [sic? Empfinden ![]() ]. Als Kinder
würden sie das Telefon niemals auseinander nehmen, aber sie würden es
vielleicht grün anmalen, wenn sie meinen, so sähe es besser
aus. Sie schmecken, riechen, sehen differenzierter
als
die Anderen. Und oft fühlen sie sich unwohl,
]. Als Kinder
würden sie das Telefon niemals auseinander nehmen, aber sie würden es
vielleicht grün anmalen, wenn sie meinen, so sähe es besser
aus. Sie schmecken, riechen, sehen differenzierter
als
die Anderen. Und oft fühlen sie sich unwohl,
weil die Dinge nicht so sind, wie sie [überzeugt] meinen,
dass sie sein sollten. 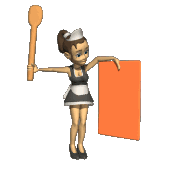 [Dass
und wie sich
[Dass
und wie sich ![]() Wahrnehmung
nicht
allein auf physiologische Subjekte
bis Objekte beschränkt, überrascht so manche, nicht
allein gpstisch-orientierte, Leute]
Wahrnehmung
nicht
allein auf physiologische Subjekte
bis Objekte beschränkt, überrascht so manche, nicht
allein gpstisch-orientierte, Leute]
Beruflich liegt ihnen alles was mit Kreativität
und Gestaltung zu tun hat. Sie
können Handwerker sein, Musiker,
Maler oder Bildhauer, Produkt- oder Modedesigner, Innendekorateure,
Köche, Konditoren, Gärtner, Architekten, Poeten, Masseure, Werbefachleute, ....
Ihr Können basiert auf ihren Gefühlen [sic!
allerdings, gar stets, ‚schulungsbedürftig‘; O.G.J. tzmal Autodidaktisches für die härtesten onehin sehr harter Wege haltend, aber gerade ups Kunst wie Kult nicht asketisch-libertinistisch mit Luxus verwechselnd] und macht den Unterschied aus zwischen einem funktionalen
Produkt und einem Lifestyle-Objekt, das einen Designerpreis gewinnen kann.“ (G.P. S. 66; verlinkende
Hervorhebungen O.G.J.)
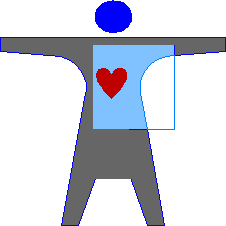 [Wobei/Wozu weder
dem (kosmischen/griechischen) Verortungsparadigma
im Raum, noch der dichotomen (oder
um ‚Psyche/Seele‘, bis ‚Gemüt/Charakter‘ oder ‚Herz/Innerstes‘ klassisch
auf drei scheinerweiterten –
gar gnostisch beeinflussten) Konfrontation
‚Geist versus Maerie‘, oder umgekehrt, gängiger
Tribut gezollt werden müsste:
[Wobei/Wozu weder
dem (kosmischen/griechischen) Verortungsparadigma
im Raum, noch der dichotomen (oder
um ‚Psyche/Seele‘, bis ‚Gemüt/Charakter‘ oder ‚Herz/Innerstes‘ klassisch
auf drei scheinerweiterten –
gar gnostisch beeinflussten) Konfrontation
‚Geist versus Maerie‘, oder umgekehrt, gängiger
Tribut gezollt werden müsste: ![]() Empfinden/Gemüht kann
& darf sowohl Gedanken-, Nerven- als auch Gefühlsreize wahrnehmen
Empfinden/Gemüht kann
& darf sowohl Gedanken-, Nerven- als auch Gefühlsreize wahrnehmen
![]() ]
]  [Auch Unlusten an/auf bestimmte/n Freu(n)de(n)
sind Interessenlagen]
[Auch Unlusten an/auf bestimmte/n Freu(n)de(n)
sind Interessenlagen]
 [Eines der
Geheimnisse] Statt reiner ‚Seh‘-, ‚Hör‘- oder ‚Hampel- äh Haptik‘-Menschen,
respektive ‚I(nteresse)-, F(re[n]de)-
oder L(ust)-Typen‘, sind die weitaus meisten, bis alle,
Leute eher als vielfältige Mischungen (auch) daraus) zu charakterisieren,
äh zu umschreiben/verstehen.
[Eines der
Geheimnisse] Statt reiner ‚Seh‘-, ‚Hör‘- oder ‚Hampel- äh Haptik‘-Menschen,
respektive ‚I(nteresse)-, F(re[n]de)-
oder L(ust)-Typen‘, sind die weitaus meisten, bis alle,
Leute eher als vielfältige Mischungen (auch) daraus) zu charakterisieren,
äh zu umschreiben/verstehen.  Rasiermesserscharfe Bügelfalten – oder wem/wann/wozu
(gar
apostolische / biblische bis devote / kluge) Schlichtheit zum Einfaltentrug
geworden?
Rasiermesserscharfe Bügelfalten – oder wem/wann/wozu
(gar
apostolische / biblische bis devote / kluge) Schlichtheit zum Einfaltentrug
geworden? 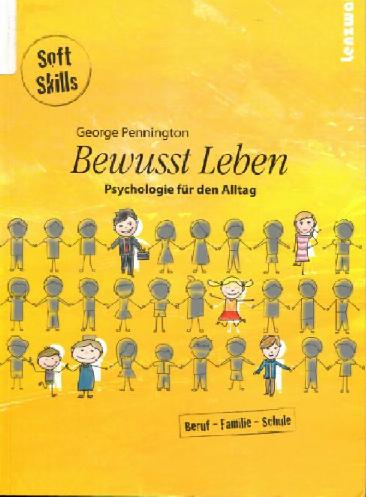 „ […] mit einem gute[n] Verständnis
[sic!] für alle drei
Bereiche, ohne sich jedoch in einem von ihnen besonders auszuzeichnen. Das ist
genau [sic! nicht
notwendigerweise völlig ausgeschlossen auch/bereits
dies Ideal ‚arbeitsteilig‘/gemeinsam hinreichend zustande zu bringen; O.G.J.
gar mit ‚gaußscher‘-Verbreitungserwartung] die Verteilung, die unabhängige Geschäftsleute brauchen:
freiberufliche Unternehmer, Gründer kleiner oder großer Unternehmen, Leiter [sic!]
von Teams und Projektgruppen. Sie kennen ihre Grenzen und
beschäftigen (und schätzen) Spezialisten mit den Talenten,
über die sie selber in diesem Maße nicht verfügen.
„ […] mit einem gute[n] Verständnis
[sic!] für alle drei
Bereiche, ohne sich jedoch in einem von ihnen besonders auszuzeichnen. Das ist
genau [sic! nicht
notwendigerweise völlig ausgeschlossen auch/bereits
dies Ideal ‚arbeitsteilig‘/gemeinsam hinreichend zustande zu bringen; O.G.J.
gar mit ‚gaußscher‘-Verbreitungserwartung] die Verteilung, die unabhängige Geschäftsleute brauchen:
freiberufliche Unternehmer, Gründer kleiner oder großer Unternehmen, Leiter [sic!]
von Teams und Projektgruppen. Sie kennen ihre Grenzen und
beschäftigen (und schätzen) Spezialisten mit den Talenten,
über die sie selber in diesem Maße nicht verfügen.
[…]
Das“ sei „heute das Drama vieler Menschen. Sie sind sehr talentiert,
finden sich aber als Fisch auf einer Weide wieder, wo man eine
Leistung [sic!] von
ihnen erwartet, für die sie nicht wirklich geeignet sind. [Zumindest
insofern eine passende ‚Diagnose‘, dass ‚moderne‘ Gesellschaften nicht darauf
warten (können) bis ihre Mitglieder hinreichend ‚weise‘ /
‚selbstverantwortlich‘ sind, um diese einsetzen zu können/wollen;
O.G.J. etwa mit P.S.]  Zwar
bekenn sich Menschen oft gerne. Ddennoch/Dabei fällt
es ihnen (notwendigerweisen/definotionsgemäß) schwerer Überzeugtheiten (denn Meinungen) zu ändern, als sie (beiderlei) zu verschweigen/vergessen!
Zwar
bekenn sich Menschen oft gerne. Ddennoch/Dabei fällt
es ihnen (notwendigerweisen/definotionsgemäß) schwerer Überzeugtheiten (denn Meinungen) zu ändern, als sie (beiderlei) zu verschweigen/vergessen!
[…]
Keine Konfiguration der
drei primären Motivatoren (Interesse, Freude, Lust)
ist besser als irgendeine andere. In unserem westlichen [sic! vgl. allerdings/sogar auch Japan, gleichwohl pluraler differenziert; O.G.J. durchaus ebenfalls wider
dortiger Individualitäten-Abmahnung, und gegen zu kurze ‚Motivations‘-Verständnisse/Forderungen bis gesinnungsethische
‚Gründe‘-Vorstellungen]  Ein ‚Genie‘ täte ja ohnehin besser/vergebens daran, sich nonverbal dafür zu entschuldigen;
nicht ganz so einfältig/erkenntnisschwach zu erscheinen wie erwartbar/gauß-normalverteilt! [Auf Anwürfe
mangelnden Respekts vor/von Anderheiten reagieren Gemeinwesen
nur allzu gern mit mehr derselben Gleichheitsforderung]
Ein ‚Genie‘ täte ja ohnehin besser/vergebens daran, sich nonverbal dafür zu entschuldigen;
nicht ganz so einfältig/erkenntnisschwach zu erscheinen wie erwartbar/gauß-normalverteilt! [Auf Anwürfe
mangelnden Respekts vor/von Anderheiten reagieren Gemeinwesen
nur allzu gern mit mehr derselben Gleichheitsforderung]
 Manche
zögen jedoch eine Verbeugung mittels
der Knie, jenen des Oberkörpers respektive des Denkens/Redens, oder ebrn das/dem
Hosentragen, vor?
Manche
zögen jedoch eine Verbeugung mittels
der Knie, jenen des Oberkörpers respektive des Denkens/Redens, oder ebrn das/dem
Hosentragen, vor?
Wertesystem; allerdings neigen wir dazu, die I-Typen, die sich für akademische Studien [sic!
namentlich nummerisch vergleichbar (scheinbar objektiv, bis justiziabel)
operationalisierte IQ-Messungen; O.G.J. nicht nur
mit G.P. an ‘soft-skills‘ interessiert und Erkenntnisintedressen
auf keinen ‚Bereich‘ beschränkend]
eignen, höher zu bewerten.“
Was auf eine Respekts[gleichheitsideal]verweigerung anderes Begabten
gegenüber
hinauszulaufen drohe. – Was allenfalls,
doch immerhin, einen Teil zumindest latenter Intellektuellenfeindlichkeit/en
‚mancher Gesellschaften‘ bis Leute illustrieren könnte (O.G,J. bösartiger).
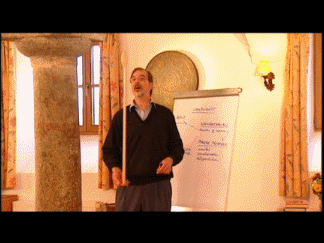 Auch/Schon Balance-Künste müssen nicht immer so einfach bis mühelos aussehen, bis wirken,
wie sie jenen, die sie ‚beherrschen‘ (kaum) vorkommen mägen. George Pennington
sei „durchaus
bewusst,
dass“ seinn „dreifaches System von primären
Motivatoren extrem einfach und keineswegs [sic! was, jenseits
‚mangelnder
begrifflicher Trennschärfen‘. jedoch vom jeweiligen ups philosophischen/theologischen
Wissenschaftenverständnis
abhängt: O.G.J. hier namentlich wider
Höherstellungspopularitäten von, an redutionistisch naturwissenschaftlichem
Empirie-Selbstverständnis
von Validitäten und Releabilitäten
befangener, differenzieller Psychologie
Auch/Schon Balance-Künste müssen nicht immer so einfach bis mühelos aussehen, bis wirken,
wie sie jenen, die sie ‚beherrschen‘ (kaum) vorkommen mägen. George Pennington
sei „durchaus
bewusst,
dass“ seinn „dreifaches System von primären
Motivatoren extrem einfach und keineswegs [sic! was, jenseits
‚mangelnder
begrifflicher Trennschärfen‘. jedoch vom jeweiligen ups philosophischen/theologischen
Wissenschaftenverständnis
abhängt: O.G.J. hier namentlich wider
Höherstellungspopularitäten von, an redutionistisch naturwissenschaftlichem
Empirie-Selbstverständnis
von Validitäten und Releabilitäten
befangener, differenzieller Psychologie ![]() ] wissenschaftlich ist. Es gibt
eine ganze Anzahl von Tools zur Beurteilung von Persönlichkeit und Charakter (personality profilers), die wissenschaftlicher [sic!] sind und mehr Differenzierung bieten, gleichzeitig aber komplizierter
und teurer sind. Sie arbeiten mit 4 (oder mehr)
grundlegenden Charaktermerkmalen, die schließlich 16 (oder mehr)
Persönlichkeitstypen ergeben.
] wissenschaftlich ist. Es gibt
eine ganze Anzahl von Tools zur Beurteilung von Persönlichkeit und Charakter (personality profilers), die wissenschaftlicher [sic!] sind und mehr Differenzierung bieten, gleichzeitig aber komplizierter
und teurer sind. Sie arbeiten mit 4 (oder mehr)
grundlegenden Charaktermerkmalen, die schließlich 16 (oder mehr)
Persönlichkeitstypen ergeben.
[…]  Skandalanfälligkeiten des Allgemeinverbindlichen
beeindrucken ja (nicht erst oder
nur/hauptsächlich Abweichende) übergriffig. [Weishet verzichtet nicht klug gemug
auf Komplexitätsreduzierungen. Wird bis ist, allenfalls intelligent genug diese
zu bemerken bis zu überdenken/offenzulegen] Monokausalismen argumentieren (sind/werden)
stets (überzeugt/dagegen beendruckt): Das Alles sei viel komplizierter als man (gemeint die abweichenden bis gegenerischen
anderen) denkle; in Tat und
Warheit, liege/sei es (kausalistisch/ursächlich,
modal/monadisch) an/in dem, was sie immer sagten / darüber lehren /
davon erkannt bis damit erlebt zu
haben gewiss, bis geborgen!
Skandalanfälligkeiten des Allgemeinverbindlichen
beeindrucken ja (nicht erst oder
nur/hauptsächlich Abweichende) übergriffig. [Weishet verzichtet nicht klug gemug
auf Komplexitätsreduzierungen. Wird bis ist, allenfalls intelligent genug diese
zu bemerken bis zu überdenken/offenzulegen] Monokausalismen argumentieren (sind/werden)
stets (überzeugt/dagegen beendruckt): Das Alles sei viel komplizierter als man (gemeint die abweichenden bis gegenerischen
anderen) denkle; in Tat und
Warheit, liege/sei es (kausalistisch/ursächlich,
modal/monadisch) an/in dem, was sie immer sagten / darüber lehren /
davon erkannt bis damit erlebt zu
haben gewiss, bis geborgen! 
Meine
[G.P.s] Landkarte
ist viel einfacher [sic!]. Der Nachteil jeder [derart ‚schlicht‘ (! anstatt etwa
einfältig oder zu
billig / populistisch / pressegeeignet) skizzierter/modellierter; O.G,J, durchaus komplexere
Standardmodelle / Landkarten des/vom Allgemeinen (er- bis gar aner)kennend:
dass/wo/welche Deteils (wem/warum) klare Konturen vernebeln] allgemein gehaltenen Landkarte ist, dass Details verloren gehen, während zu detaillierte
Landkarten
die klare
Einfachheit  [sic! lexikalisch korrekt lassen sich bekanntlich
sowohl /jaxid/ als auch /exad;axat/
mit/in/hinsichtlich ihrem Gemeinsamen übersetzen; falsch/‚gnostisch‘
bleibt daher dennoch ‚Einheit‘ und\aber ‚Einzigkeit/Universum‘
für
ein und Dasselbe zu halten; O.G.J.
Presse- und Forschungsfreiheit verteidigend anstatt mit Beliebigkeit/Allmacht, äh Hyperrealität, verwechselnd: ‚Das mechanische Weltbild‘ für (bestenfalls)
unzureichend (‚vollständigen Determinismus‘ sogar für
gefährlich töricht) haltend] des Überblicks verlieren. Ich mag
Einfachheit. [sic! jene Errungenschaft indoeuropäischer
Sprachen/Denkweise, die (insbesondere griechischer, grammatikalisch/logisch vereindeutigt
recht- nein machtbaberischer) Reduktionismus zur hohen/durchaus wissenschaftlich-technologischen
Blüte, bis platonischen
Vergottung / Verwechslung respektive Gleichsetzung
von Empirie mit Wahrheit
(als/zu ‚rein‘, ‚schön‘.
‚einfach‘, ‚geordnet‘
– eben ‚kosmisch‘ / ‚unwidersprechbar-scheinend‘) getrieben hat;
O.G.J. auch/sogar in ‚apostolischen Schriften‘, Gnosis-fündig‘, bis (gegenwärtige) Popularisierbarkeiten
entblößend]
[sic! lexikalisch korrekt lassen sich bekanntlich
sowohl /jaxid/ als auch /exad;axat/
mit/in/hinsichtlich ihrem Gemeinsamen übersetzen; falsch/‚gnostisch‘
bleibt daher dennoch ‚Einheit‘ und\aber ‚Einzigkeit/Universum‘
für
ein und Dasselbe zu halten; O.G.J.
Presse- und Forschungsfreiheit verteidigend anstatt mit Beliebigkeit/Allmacht, äh Hyperrealität, verwechselnd: ‚Das mechanische Weltbild‘ für (bestenfalls)
unzureichend (‚vollständigen Determinismus‘ sogar für
gefährlich töricht) haltend] des Überblicks verlieren. Ich mag
Einfachheit. [sic! jene Errungenschaft indoeuropäischer
Sprachen/Denkweise, die (insbesondere griechischer, grammatikalisch/logisch vereindeutigt
recht- nein machtbaberischer) Reduktionismus zur hohen/durchaus wissenschaftlich-technologischen
Blüte, bis platonischen
Vergottung / Verwechslung respektive Gleichsetzung
von Empirie mit Wahrheit
(als/zu ‚rein‘, ‚schön‘.
‚einfach‘, ‚geordnet‘
– eben ‚kosmisch‘ / ‚unwidersprechbar-scheinend‘) getrieben hat;
O.G.J. auch/sogar in ‚apostolischen Schriften‘, Gnosis-fündig‘, bis (gegenwärtige) Popularisierbarkeiten
entblößend]  Der französische Pilot und
Autor Antoine de St. Exupery schrieb einmal: La vérité c'est ce
qui simplifie.43 [(franz): Die Wahrheit ist das, was vereinfacht /
Kontraste maximiert,
erregt; O.G.J. nenemo- bis motivational sensitiv.] Ich [G.P.] würde [sic!]
sagen:
Der französische Pilot und
Autor Antoine de St. Exupery schrieb einmal: La vérité c'est ce
qui simplifie.43 [(franz): Die Wahrheit ist das, was vereinfacht /
Kontraste maximiert,
erregt; O.G.J. nenemo- bis motivational sensitiv.] Ich [G.P.] würde [sic!]
sagen: ![]() Sogar/Gerade
gute Modelle, nicht alleine erst holzschnittunartige
Vereinfachungen פֵּא /pschat/ des ‚( redebden) Mundes‘ פֵּה sprachlicher/schriftlicher
Repräsentationen, sind/werden
zwar immer falsch (da unterkomplex und zugleich verschärfend/übertriebend, bis kontrasklar
/übergriffig handhabbar) deswegen und davon aber weder verzichtbar noch verbotene
Gottes-/Singular- äh Wahrheitenlästerung! [Zumindest
Philosophie sei (so/für
P.S.) ein insofern ‚verhältnismäßig unbescholtener
Beruf‘; Realitäten eher selten (Wenn auch zumeist ‚einzahlig‘/indoeuropäisch;
O.G.J. soweit mit Ma.Ga.) so kompliziert zu erklären
versucht zu haben, dass sie niemand (mehr) verstanden habe: ‚(Gar immer mehr) Leute verstehen nix – da‘ eien ‚dann ‚dunkle Mächte am Werk, die im
Hintergrund die Strippen ziehen‘; O.G.J. etal. wider Vollständigkeitshoffnungen des deterministischen Überblicks ‚mechanischer Weltbilder‘]
Sogar/Gerade
gute Modelle, nicht alleine erst holzschnittunartige
Vereinfachungen פֵּא /pschat/ des ‚( redebden) Mundes‘ פֵּה sprachlicher/schriftlicher
Repräsentationen, sind/werden
zwar immer falsch (da unterkomplex und zugleich verschärfend/übertriebend, bis kontrasklar
/übergriffig handhabbar) deswegen und davon aber weder verzichtbar noch verbotene
Gottes-/Singular- äh Wahrheitenlästerung! [Zumindest
Philosophie sei (so/für
P.S.) ein insofern ‚verhältnismäßig unbescholtener
Beruf‘; Realitäten eher selten (Wenn auch zumeist ‚einzahlig‘/indoeuropäisch;
O.G.J. soweit mit Ma.Ga.) so kompliziert zu erklären
versucht zu haben, dass sie niemand (mehr) verstanden habe: ‚(Gar immer mehr) Leute verstehen nix – da‘ eien ‚dann ‚dunkle Mächte am Werk, die im
Hintergrund die Strippen ziehen‘; O.G.J. etal. wider Vollständigkeitshoffnungen des deterministischen Überblicks ‚mechanischer Weltbilder‘]  Spätestens
Wahrheit. Nicht nur Theorie/totat reduziert
Realitäten auf einen Kern, den diese (auch abgebildfet
repräsentierte Handlungen dadurch) gar nicht haben. [Der ‚Gebrauchswert‘
des (gar
singulären bis universellen) Wahrheitsbegriffes ist
so/zu(verlässig!/?) groß, dass … Euer Gnaden wissen schon was/wie
‚Erklärungen‘ (nicht) sind] Praxis,
Politik und/oder Publizistik?
Spätestens
Wahrheit. Nicht nur Theorie/totat reduziert
Realitäten auf einen Kern, den diese (auch abgebildfet
repräsentierte Handlungen dadurch) gar nicht haben. [Der ‚Gebrauchswert‘
des (gar
singulären bis universellen) Wahrheitsbegriffes ist
so/zu(verlässig!/?) groß, dass … Euer Gnaden wissen schon was/wie
‚Erklärungen‘ (nicht) sind] Praxis,
Politik und/oder Publizistik? 
Wenn es [eine/die
Erklärung – wem/wozu? O.G.J.
פשט׀פשע bis
politisch fragend] zu kompliziert
ist, hilft
es nicht [verhaltensändernd? O.G.J. ‚schweinehundgerecht‘
mit M.v.M. und V.F.B.:
Wenn es zu einfach ist, langweilt bis unterbleibt, es – oder verführt zu
Übergriffigkeiten] .
 Stets ‚pedantisch streng‘, äh ‚gutachterlich
perfekt‘ – im Kellerfaltenrock! [‘Keep
it simple and stupid!‘ – Nur ‚demotiviert‘
und verleitet Unterforderung
ähnlich wie Überforderung] Meine [G.P.s] Absicht ist […] Stoff zum Nachdenken und zur Selbstreflexion zu geben. Nicht
mehr [sic! ‚Was (mindestens
aber wer, auch immer) O.G.J. half – wird Ihnen, Euer Gnaden schaden (können), mancherlei Gleichheitsideen eher inklusive].“
Stets ‚pedantisch streng‘, äh ‚gutachterlich
perfekt‘ – im Kellerfaltenrock! [‘Keep
it simple and stupid!‘ – Nur ‚demotiviert‘
und verleitet Unterforderung
ähnlich wie Überforderung] Meine [G.P.s] Absicht ist […] Stoff zum Nachdenken und zur Selbstreflexion zu geben. Nicht
mehr [sic! ‚Was (mindestens
aber wer, auch immer) O.G.J. half – wird Ihnen, Euer Gnaden schaden (können), mancherlei Gleichheitsideen eher inklusive].“ 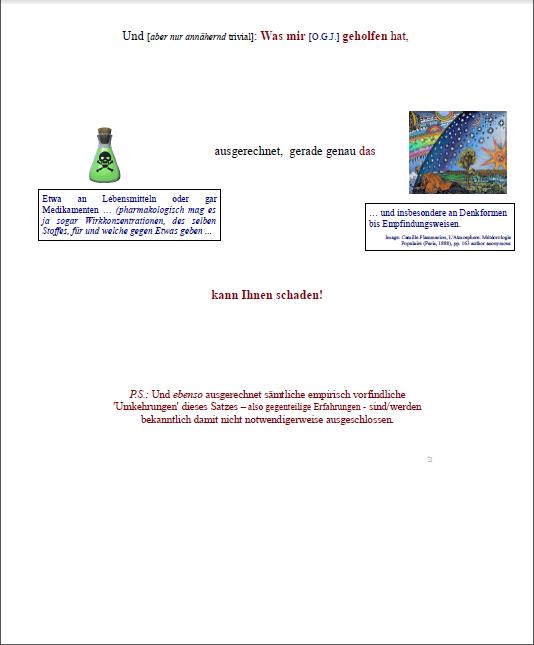 Menschen „scheinen auf der Basis der (nur)
drei Motivatoren viel Verständnis [sic!]
für sich
selber und ihre Lebenssituation, für ihre
Familien, Lebenspartner, Freunde und Kollegen zu entwickeln.
Menschen „scheinen auf der Basis der (nur)
drei Motivatoren viel Verständnis [sic!]
für sich
selber und ihre Lebenssituation, für ihre
Familien, Lebenspartner, Freunde und Kollegen zu entwickeln.
[…]
[‚Doch
leider tue ich es aus Neigung‘ lächelte Heinrich Heine, der kantianischen
Pflichtethick zu(rück), so dass es/er nicht
dementsprechend tugendhaft] [Sir George auch ‚inhaltlich‘/typologisierend, anteilig in Sachen / nach ‚(Erkenntnis-)Interesse‘,
‚(zumal
sozial-verbundener) Freude‘ und
‚Lust/Wohlsein‘ weiter zitierwürdig/beachtlich]
[Sir George auch ‚inhaltlich‘/typologisierend, anteilig in Sachen / nach ‚(Erkenntnis-)Interesse‘,
‚(zumal
sozial-verbundener) Freude‘ und
‚Lust/Wohlsein‘ weiter zitierwürdig/beachtlich] 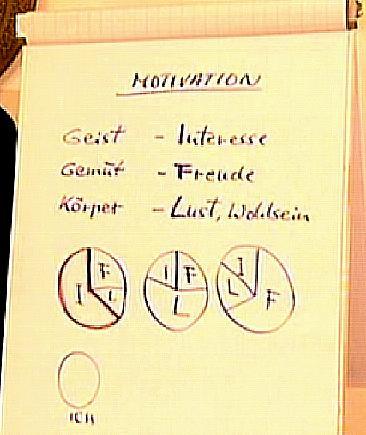
„Die Neigungen von Menschen kann man leicht an der Art von Fragen
erkennen,
die sie stellen. Der I-Typ wird Fragen stellen in der Absicht, sein oder ihr Wissen
und Verständnis
[keineswegs nur von nichtsozialen Sach- bzw. Menschenverhalten O.G.J.] zu erweitern, der F-Typ wird wahrscheinlich mehr an den
sozialen Aspekten interessiert[sic!] sein, während der L-Typ eher Qualitäten und
Annehmlichkeiten betonen wird. Auf einer Party wird der I-Typ dazu neigen Sie
in einen Dialog
über irgendein Sachthema zu verwickeln, während die mehr sozial Begabten
Neuigkeiten über gemeinsame Freunde
und Bekannte austauschen. Der L-Typ wird eher an der Qualität der
Speisen und Getränke, an der Dekoration des Raumes oder der Schönheit eines
Kleides interessiert[!]
sein und diese kommentieren. Wenn die verschiedenen Typen zusammen kommen, kann es sein, dass sie eine
gewisse Inkompadbilität feststellen. Jeder
hat eben seine eigene Art[en
und Weusen Dinge bzw. Ereignisse
für wesentlich, bis andere für ‚dummes/unnötiges Zeugs‘ zu
halten; O.G.J. ‚spieltheoretisch/er‘
Konflikte-deutend]. 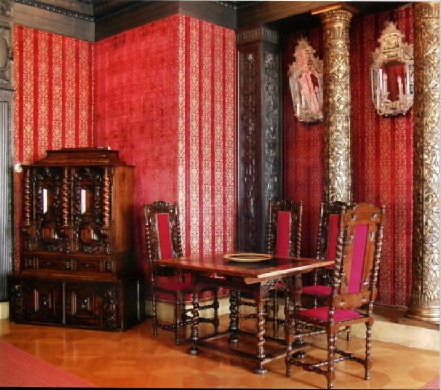
[…]
Die persönlichen Bedürfnisse sind von Mensch
zu Mensch verschieden. Wie auch immer sie sind, niemand außer uns selber
wird sicherstellen [sic! ‚Garantien‘ versprechen im Übrigen/ansonsten
allerdings eher jene, die ‚meine Begabungen/Bedürfnisse besser zu
sehen/wissen behaupten‘, als ich selbst; O.G.J. durchaus
überzeugt, dass außer ‚(es Übel- und) Wohlmeinenden‘ auch
geeignete ‚Spiegel‘ (gar inklusive professioneller Job- bis Heirats-Vermittlungen/Makler),
auch ‚gegenpolfähige‘ Freunde,
unterwegs], dass wir auch
bekommen, was wir brauchen [sic!
wobei, bis wogegen, mächtig( erscheinend)e ‚Interessen‘ tätig sein/werden
mögen; O.G.J. wenig ‚verschwörungstheoretisch‘ äh ‚behinderungsbewusst‘ / ‚gesellschaftsreformerisch‘, ‚(zumal negative Diskriminierungs-)Schuld / Krankheit zuweisend‘ oder ‚nutzen-‚ bis ‚bevormundungsfreundlich‘ – sondern
eher ‚Begabung-versus/gleich-Bedürfnis‘-kritisch
und (subsitutions- bis dazu)lernfähig, insbesondere aber geradezu ‚für Kompromisse-anfällig‘ an,, gar gegenläufig begabten, Neigungen/Bedürfnissen
des/der anderen Menschen, orientiert]“ (G.P. S. 67 ff. ; verlinkende und
fett-gedruckte Hervorhebungen O.G.J.) 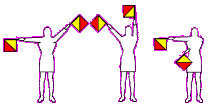 [Den eigenen / ups-meinen Standort-QTH (hier unten namentlich Bedürfnisse) zu (er-/be)kennen hilft,
bis ermöglichst gar erst, darüber hinaus, auf andere zu / an ihnen Euer Gnaden vorbei, zu gehen]
[Den eigenen / ups-meinen Standort-QTH (hier unten namentlich Bedürfnisse) zu (er-/be)kennen hilft,
bis ermöglichst gar erst, darüber hinaus, auf andere zu / an ihnen Euer Gnaden vorbei, zu gehen]
|
[‚Sieht
gar ‚trivialer‘ aus‘, als ‚die Polizei‘ erlaubt/hofft: Auch/Gerade ‚(sogar All-)Wissenheit‘ (inklusive
Strafkenntnis) verhindert keinen Fehler. – (Suchende)
Menschen tun und/oder unterlassen Aktionen]
|
Allerdings
scheint es Menschen zu geben
die, jedenfalls Situationen in
denen sie/wir, hinreichend ‚genau‘/umfassend
‚wissen‘,
[Nicht nur Bekleidungsfragen erweisen sich
eher als Wahlentscheidungen aus Möglichkeitenspielräumen
– denn als vollständig determiniert(e Uniformität/Universalien äußerlichen Beweises
äh Ausdrucks innerlich eindeutiger Zustände)] |
[Allumfassende
Bewusstheit habe als kontemplativer
Zustand handlungsunfähigen Verhaltens zu gelten – und ו oder װ aber]
[‚Geheimnis(voll)‘ וד am/im PaRDeS-Konzept-פרד״ס semitischen/nichtredktionistischen
Denkens, nichts gegen Komplexitäten. jenes der Grenzenränder
(meines) begreifenden Verstehens / Beabsichtigtens,
unternehmen zu müssen] |
was sie tun – um dieses auch unterlassen/ändern zu
können! – Nicht alleine mögliche Verfehlungen (auch ‚kein Ziel zu haben‘ kann ein legitimes [Sorry oder auch nicht einmal das – jedoch Knicks] |
[Immerhin
helfe Weisheit /chochma/ חכמה aus Situationen wieder heraus, in die
Klugheit gar nicht erst hineingeraten liese. –
Intelligente חכמה Immunisierung gegen für/als/mit
‚böse/schlecht‘-Erklärtes/Zuhaltendes,
jedenfalls wider manch
nicht-gesucht-Zufallendes, sei/werde möglich/erlaubt] |
Interessant
erscheint manchen, wenigstens aber beeindrucken kann, auch die ordnende Einteilung
und Umschreibung in z.B. neun oder zwölf (mal fünf, bis mal zwölf)
Charaktertiere (äh –tere, die sich dann einfach aus Eigennahmen - deren
zutreffende Benennung einer Person, bis Persönlichkeit,
dazu nicht unbedingt unterstellt werden muss, aber gerne wird – errechnen 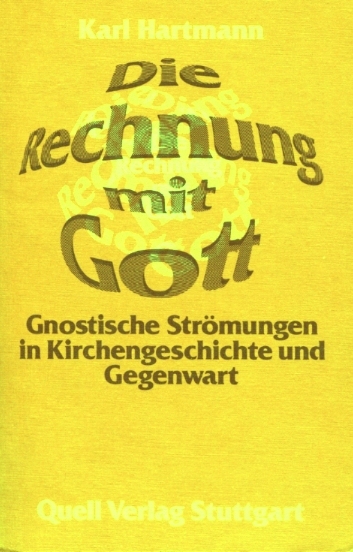 lassen – etwa indem die Buchstabenreihenfolge
von eins bis neun und wieder von vorne beginnend durchnummeriert und
schließlich einstellige Quersummern ‚errechnet‘ werden).
lassen – etwa indem die Buchstabenreihenfolge
von eins bis neun und wieder von vorne beginnend durchnummeriert und
schließlich einstellige Quersummern ‚errechnet‘ werden).
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
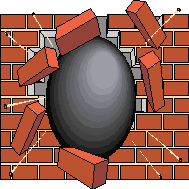 (Denn:)
Gar noch fundamentaler – also zwischen/als ‚gut/besser
versus böse/schlecht‘ – eingemauert sind
und werden hier unten auch begriffliche und inhaltliche
Vorverständnisse und -urteile über sich und/oder andere
Menschen, bzw. jene vieler Leute:
(Denn:)
Gar noch fundamentaler – also zwischen/als ‚gut/besser
versus böse/schlecht‘ – eingemauert sind
und werden hier unten auch begriffliche und inhaltliche
Vorverständnisse und -urteile über sich und/oder andere
Menschen, bzw. jene vieler Leute: 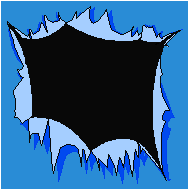
Das englische Wort ‘character‘ läßt sich ja durchaus (überwiegend nicht nur aus diesem
zeitgenössischen ‚Neulatein‘) mit/in ‚Rolle‘, zumal im Sinne eines – gar überzeichneten
– ‚Charakter(typu)s‘ im verdeutlichenden
(Schau- oh, gar gleich noch größerer Schreck: )Spiel,
übersetzen.  (Typischerweise,
ohne dass die omnipräsenten Warnungen
vor der angeblichen ‚Nichtrealität‘ des Spiels, ausreichen würden, die
Identifizierungen der Repräsentationen/Typologien mit den Repräsentierten/Menschen in/unter die selben/ernsthafte Fragen/Zweifel zu ziehen.)
(Typischerweise,
ohne dass die omnipräsenten Warnungen
vor der angeblichen ‚Nichtrealität‘ des Spiels, ausreichen würden, die
Identifizierungen der Repräsentationen/Typologien mit den Repräsentierten/Menschen in/unter die selben/ernsthafte Fragen/Zweifel zu ziehen.) 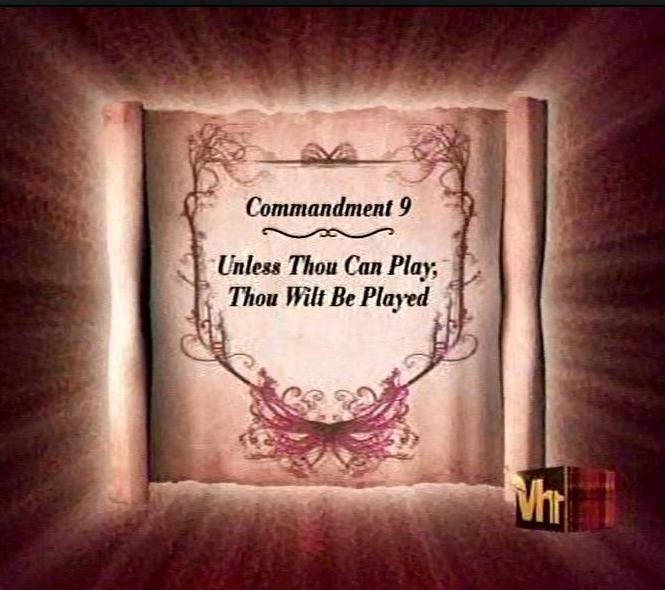 Gefahr: Solange Sie/Euer Gnaden
nicht spielen können, wird mit Ihnen/Euch gespielt werden können. Folgsamere
Übersetzungen
Gefahr: Solange Sie/Euer Gnaden
nicht spielen können, wird mit Ihnen/Euch gespielt werden können. Folgsamere
Übersetzungen 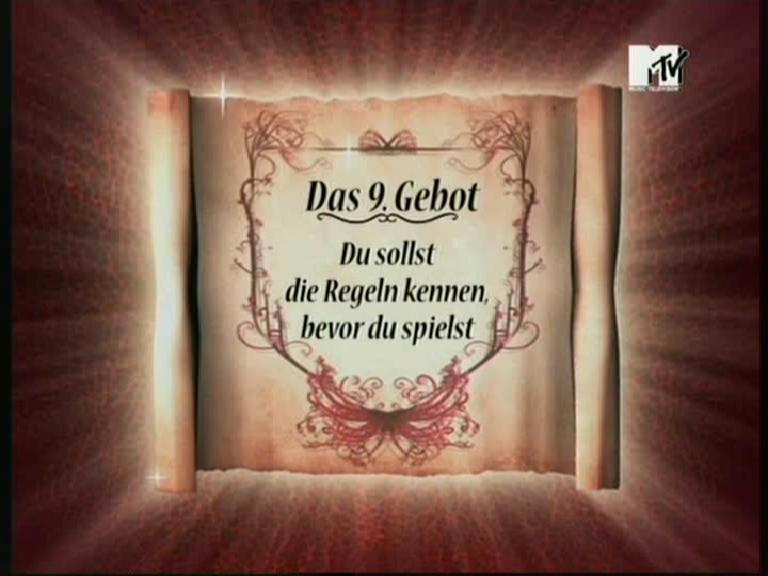 bleiben
zudem eher unzureichend hinterm Bedeutungenspektrum zurück.
bleiben
zudem eher unzureichend hinterm Bedeutungenspektrum zurück.  Denn:
Spiel(theorie) ist weder ‚kindisch unernste/leichtfertige/naive
Verantwortungslosigkeit‘, noch immer ‚unehrenhaft/unseriös‘ (und auch nicht ‚in unnützen/unproduktiven,
funktionslosen‘ Arten und Weisen
außerhalb der Realität/en – kann & darf aber denkerische,
bis emotionale, Bewusstheiten, bis
reflektierende Distanzen, davon und durchaus oh
Schreck ‚kindliche‘ Alternativen
damit/darin/dazu, ermöglichen). – folglich alles andere als harmlos (zumal weder völlig ‚glücksfrei‘ noch vollständig ‚berechenbar‘).
Denn:
Spiel(theorie) ist weder ‚kindisch unernste/leichtfertige/naive
Verantwortungslosigkeit‘, noch immer ‚unehrenhaft/unseriös‘ (und auch nicht ‚in unnützen/unproduktiven,
funktionslosen‘ Arten und Weisen
außerhalb der Realität/en – kann & darf aber denkerische,
bis emotionale, Bewusstheiten, bis
reflektierende Distanzen, davon und durchaus oh
Schreck ‚kindliche‘ Alternativen
damit/darin/dazu, ermöglichen). – folglich alles andere als harmlos (zumal weder völlig ‚glücksfrei‘ noch vollständig ‚berechenbar‘).
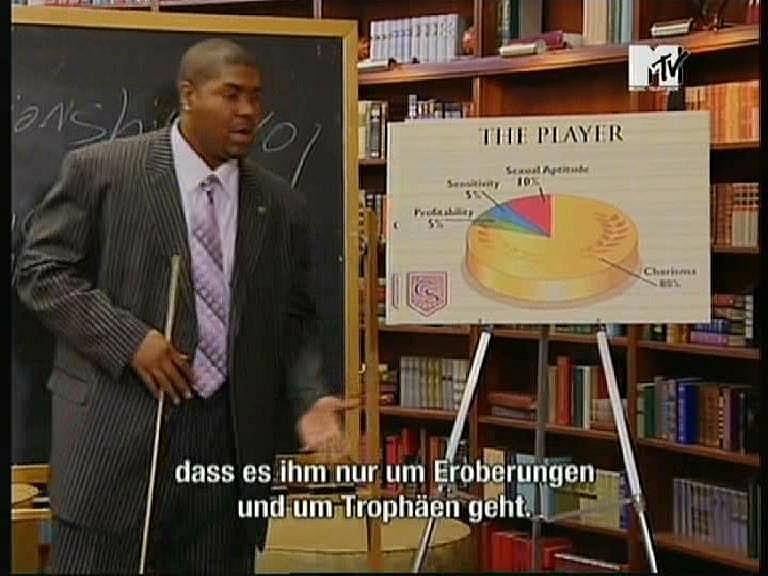
![]() Homo ludens
– weder immer
so abgrundtief schlecht, wie ihr Ruf – noch je so
fair, wie sie sich zu gerne brav geben, bis selbst
sehen, sollen und
gar wollen.
Homo ludens
– weder immer
so abgrundtief schlecht, wie ihr Ruf – noch je so
fair, wie sie sich zu gerne brav geben, bis selbst
sehen, sollen und
gar wollen.
Some video still images
© copyright by mtv or ABC productions/Kinowelt.
 Fragen
danach, und damit (zumal verhaltensfaktische, oft eher unreflektierte,
denn ausdrücklich behauptete/beanspruchte) Antworten
darauf, ‚was/wer ‚Charaktere‘/Eigenschaftenkonstellationen beeinflusse, bis bestimme?‘ ‚Ob und inwieweit
diese wann, wie starr/veränderbar, bis wirksam,
seien?‘ Und ‚welche Wechselbeziehungen/Zusammenhänge mit/zu Individualitäten, bis Persönlichkeiten, bestehen mögen?‘, gehören anscheinend zu den besonders wichtigen (gar heimlichen, bis unheimlichen) Aufgaben des
und der Menschen (im
Umgang mit, bis zum Erklären/Verstehen von, ‚ihresgleichen‘,
respektive sich selbst, äh
Anderer). – Nicht
etwa allein, dafür allerdings schon recht lange – und diesbezüglich eher selten bemerkt, sondern bereits (dichotomisierend im ‚Sichtweisenfirmament‘)
nach ‚richtig/nützlich‘ oder ‚böse/unbrauchbar‘[O.G.J.1] geordnet –
widerstreiten sich bis einander
Astrologie/n, und inzwischen auch so manche psychologische
Theorie/Schule, in
Anzahlen/Reichweiten und (eher idealtypischen/holzschnittartigen)
Darstellungen von Kategorien, zur beschreibenden (bis
beeinflussen s/wollenden) Repräsentation/Erfassung von, gar durchaus, Vorfindlichem/Beobachtbarem.
Fragen
danach, und damit (zumal verhaltensfaktische, oft eher unreflektierte,
denn ausdrücklich behauptete/beanspruchte) Antworten
darauf, ‚was/wer ‚Charaktere‘/Eigenschaftenkonstellationen beeinflusse, bis bestimme?‘ ‚Ob und inwieweit
diese wann, wie starr/veränderbar, bis wirksam,
seien?‘ Und ‚welche Wechselbeziehungen/Zusammenhänge mit/zu Individualitäten, bis Persönlichkeiten, bestehen mögen?‘, gehören anscheinend zu den besonders wichtigen (gar heimlichen, bis unheimlichen) Aufgaben des
und der Menschen (im
Umgang mit, bis zum Erklären/Verstehen von, ‚ihresgleichen‘,
respektive sich selbst, äh
Anderer). – Nicht
etwa allein, dafür allerdings schon recht lange – und diesbezüglich eher selten bemerkt, sondern bereits (dichotomisierend im ‚Sichtweisenfirmament‘)
nach ‚richtig/nützlich‘ oder ‚böse/unbrauchbar‘[O.G.J.1] geordnet –
widerstreiten sich bis einander
Astrologie/n, und inzwischen auch so manche psychologische
Theorie/Schule, in
Anzahlen/Reichweiten und (eher idealtypischen/holzschnittartigen)
Darstellungen von Kategorien, zur beschreibenden (bis
beeinflussen s/wollenden) Repräsentation/Erfassung von, gar durchaus, Vorfindlichem/Beobachtbarem. 
Zumindest insofern
Wesensmerkmale bzw. Mentalitäten von Menschen grundsätzlicher
bzw. entscheidender, als deren zu
‚Charakterzügen‘ verfestigte ‚natürlichen
und\aber kultürlichen‘ Eigenschaften sein/werden
können, scheinen solche hier durchaus mit- bis
hauptsächlich/zentral ‚eingemauert‘ –
und sind keineswegs längst zureichend beschrieben.
 File:///C:/Wissen/Lexi/W3-Lexika/Wikipedia/charakter_collage.jpg
File:///C:/Wissen/Lexi/W3-Lexika/Wikipedia/charakter_collage.jpg
 File:///C:/Wissen/Lexi/W3-Lexika/250px-Melencolia_I.jpg
File:///C:/Wissen/Lexi/W3-Lexika/250px-Melencolia_I.jpg
 File:///C:/Wissen/Lexi/W3-Lexika/180px-Vier_Elemente_der_Alchemie.svg.png
File:///C:/Wissen/Lexi/W3-Lexika/180px-Vier_Elemente_der_Alchemie.svg.png
Reizbarkeit
/ Irritibility
«in der ![]() Psychologie
versteht man darunter» im Unterschied zur
Psychologie
versteht man darunter» im Unterschied zur
![]() Biologie die
Lebewesen unter anderem als Reizverarbeitungswesen
begreift, die affizierbar/durch Reize, Sinneseindrücke, Gründe ete pp. zu
beeinflussen sind, erst bzw. tot gar nicht mehr reizbar (doch
verhaltensunausweichlich allenfalls manchen ein Reiz) seind/wären
Biologie die
Lebewesen unter anderem als Reizverarbeitungswesen
begreift, die affizierbar/durch Reize, Sinneseindrücke, Gründe ete pp. zu
beeinflussen sind, erst bzw. tot gar nicht mehr reizbar (doch
verhaltensunausweichlich allenfalls manchen ein Reiz) seind/wären
 [Eine der typischen Defizitsichtweisen, die
zur Beleidigung menschlicher Arroganz (anstatt zweck)dienlich – eine wichtige
Interaktionsvoraussetzung verstellend/verdubkelnd]
[Eine der typischen Defizitsichtweisen, die
zur Beleidigung menschlicher Arroganz (anstatt zweck)dienlich – eine wichtige
Interaktionsvoraussetzung verstellend/verdubkelnd]
«eine Neigung situationsunadäequat
[wer jedpch darüber entscheidet was wann angemessen sei und was nicht, ist
jedoch keineswegs trivial – und längst nicht allein psychologisch sondern allen
Modakitäten zugehörig]
mit Zorn
[sic! vgl. zudem in welch
denkwürdig Aggression-Verruf alles Thymotische geraten, bis gerückt, worden ist; P.S. bis Franz von Asisi und Freiin Mari],
![]() Nörgelei oder Wutanfällen
zu reagieren.
Nörgelei oder Wutanfällen
zu reagieren.
Krankhafte Reizbarkeit im
weiteren Sinne bedeutet ein überstarkes [sic!]
Ansschlagen aller [oder bestimmter]Affekte. Im Allgemeinen versteht man aber
unter Reizbarkeit die besondere Tendenz zu Ärger, Zorn
und Wut.» (Eugen Bleuler 1916,
verlinkende [Hervorhebungen; O.G.J.)
In diesem ![]() psychologischen Sinne kann ‚Gelassenheit‘
– prompt variantenreiches, hochgelobtes
‚Mitglied‘ so mancher Tugendkataloge und
mindestens in den zwei geläufigen Richtungen (als
Vorwurf bzw. Provokation) missbrauchbar – als ein (statt ‚der einzige‘) Gegenpol von
Reizbarkeit / Empfindsamkeit verstanden; und es
können Unterschiede zwischen (gar
den selben) Menschen (zu verschiedenen Zeitpunkten und zwischen Individuuen)
beschrieben werden.
psychologischen Sinne kann ‚Gelassenheit‘
– prompt variantenreiches, hochgelobtes
‚Mitglied‘ so mancher Tugendkataloge und
mindestens in den zwei geläufigen Richtungen (als
Vorwurf bzw. Provokation) missbrauchbar – als ein (statt ‚der einzige‘) Gegenpol von
Reizbarkeit / Empfindsamkeit verstanden; und es
können Unterschiede zwischen (gar
den selben) Menschen (zu verschiedenen Zeitpunkten und zwischen Individuuen)
beschrieben werden.
Spätestens seit der Antike ist belegt, dass solche
Differenz-Befunde sowohl zu erklären und zu kategorisieren, als auch zu handhaben bzw. zu beeinflussen/ändern
wersucht werden.
Temperamentsunterschiede
hängen recht deutlich mit genetischen Faktoren, respelktive mit der
Gehirnchemie, zusammen (zu hohe Reizbarkeit – alao, dass ‚sich‘, das ‚wie jemand gerade drauf ist‘ / die ‚Affecktlage‘,
rasch ändert – wird diesbezüglich heute unter anderem, als
ein ‚Mangel‘ am Botenstoff Serotonin. verstanden/erklärt).
Was die Möglichkeiten des und der Menschen, sich zu sich
selbst zu verhalten, ja gerade nicht ausschließt – sondern eher erweitert/n würde.
Was im biographischen
Lebensverlauf zu den Temperamenteigenschaften eines Menschen hinzukomme und
sich daraus entwickle wird – verstanden als ‚Wechselwirklung zwischen ![]() biologischen Gegebenheiten und der Lebensgeschichte –
‚Charakter‘-genannt.
biologischen Gegebenheiten und der Lebensgeschichte –
‚Charakter‘-genannt.
![]() '‘Nervöse Unruhe‘ gilt ... Sie/Euer Gnaden
wissen schon.
'‘Nervöse Unruhe‘ gilt ... Sie/Euer Gnaden
wissen schon.
![]() Womöglich noch geläufiger/beliebter (als die Problemstellung der
Änderungsgeschwindigkeit von Affektlagen) erscheint die Erklärung von
Persönlichkeitseigenschaften mittels/durch das sogenannte ‚Dopamin-System‘ und
‚dessen‘ genetischer ‚Varianzbreite‘ / Polimorphismus (etwa die Vielgestaltigkeit des A33050C, auf
Gen VMAT2 in/auf Chromosom 10; vgl. Dean Hammer 2004 - viel präzieser ist
das menschliche Genom, in dem Fall ein Eiweiß zur Verpackung, dem Transprt und
der Bereithaltung von Dopamin an Nervenzellenden/Synapsen, nämlich bisher nicht
'entschlüsselt') über die Bevölkerungsgesamtheit. - Ihm (dem dann vermehrt ausgeschütteten Dopamin,
wenn etwas 'besser [sic!] als erwartet' erlebt werde; M.S.)
wird sogar zupoularisiert:
Den Dingen, Personen und Ereignissen (etwas genauer: den, manchmal sogar als 'Lernen'
bezeichneten, Erinnerungsintensitäten daran, und zwar hinsichtlich der Wiederholungsantriebe derselben)
Womöglich noch geläufiger/beliebter (als die Problemstellung der
Änderungsgeschwindigkeit von Affektlagen) erscheint die Erklärung von
Persönlichkeitseigenschaften mittels/durch das sogenannte ‚Dopamin-System‘ und
‚dessen‘ genetischer ‚Varianzbreite‘ / Polimorphismus (etwa die Vielgestaltigkeit des A33050C, auf
Gen VMAT2 in/auf Chromosom 10; vgl. Dean Hammer 2004 - viel präzieser ist
das menschliche Genom, in dem Fall ein Eiweiß zur Verpackung, dem Transprt und
der Bereithaltung von Dopamin an Nervenzellenden/Synapsen, nämlich bisher nicht
'entschlüsselt') über die Bevölkerungsgesamtheit. - Ihm (dem dann vermehrt ausgeschütteten Dopamin,
wenn etwas 'besser [sic!] als erwartet' erlebt werde; M.S.)
wird sogar zupoularisiert:
Den Dingen, Personen und Ereignissen (etwas genauer: den, manchmal sogar als 'Lernen'
bezeichneten, Erinnerungsintensitäten daran, und zwar hinsichtlich der Wiederholungsantriebe derselben)
mehr oder weniger ‚Glück‘
respektive Glücksgefühlspotenziale,
Intensitätsmaße/Empfänglichkeiten
für Spiritualität bzw. Intuitionen,
gar für Vertrauen(sfähigkeit)
zu versehen.
Was angeblich bzw.
zirkelschlüssig aus den - hiermit
keineswegs bestrittenen, sonderen erwarteten - empirischen Befunden
gefolgert wird: Dass messbar Mehr dieses Nerotransmitters / Gehirnbotenstoffes
signifikannt häufig mit einem (weniger
leich messbaren doch immerhin erfrag- und beobachtbaren)
Mehr (bis gar krankhaft
klassiofiziertem Zuviel/Zuwenig) der Glücksneigung oder Dankbarkeitstiefe, Vertrauensbereitschaft
und Intuitivität (namentlich verstanden als Bedeutungserkenntnis hinter/unter dem
Offensichtlichen/ Oberflächlichen / Äusseren), eben mit dem was einem
wichtig ist, auftritt/korreliert.
[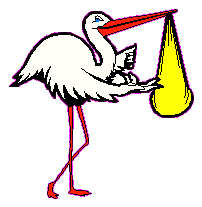 Dabei
mag immerhin deutlich werden, dass zumindest die ursprüngliche Entscheidung Dopamin anzufordern bzw. (das verfügbare) zu verwenden, keine des
Dopaminsystems ist. Auch, gerade und selbst für den bzw, im aktuell
gegenwärtugen Augenblick
Dabei
mag immerhin deutlich werden, dass zumindest die ursprüngliche Entscheidung Dopamin anzufordern bzw. (das verfügbare) zu verwenden, keine des
Dopaminsystems ist. Auch, gerade und selbst für den bzw, im aktuell
gegenwärtugen Augenblick
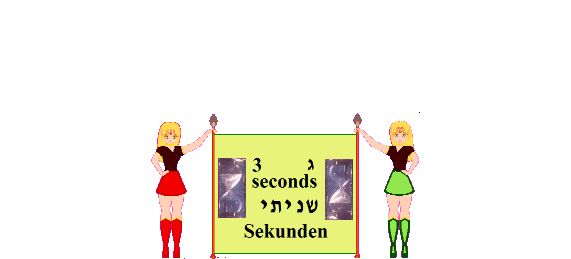 ist es (Dopamin) eines Ihrer/der
‚Pferde‘, über das Euer Gnaden verfügen, oder es/diese
(zumal mit bis aus Ihnen)
machen lassen, können (was Sie selbst so nicht wolleten müssen – aber
dennoch zu verantworten haben).
ist es (Dopamin) eines Ihrer/der
‚Pferde‘, über das Euer Gnaden verfügen, oder es/diese
(zumal mit bis aus Ihnen)
machen lassen, können (was Sie selbst so nicht wolleten müssen – aber
dennoch zu verantworten haben).
![]() ‚Demut‘,
‚Demut‘,
- bekanntlich (bis verdrängtermassen)
eine andere der, eben als Dienstbarkeit bis
Erniedrigung, am gründlichsten missverstandenen,
wenigstens und dafür aber ganz besonders – eben zu, zumal den unvermeidlichen, Unterwerfungen (und als
solche) – missbrauchten Eigenschaften bzw.
Bedürfnissen des bis der Menschen überhaupt –
gehärt drüben zu Herzensfragen der und an die Lageuentrale. – Die Unterschiede zwischen Demut und Demütigung sind
größer und wichtiger als so manche, mindestens sprachliche, Angleichungs- und Zusammenhangsversuche zu suggerieren
trachten.
-Maennertypenlehren – gar in provokannt
vereinfachen s/wollenden bis diffamierender, äh
den besten aufklärend ‚informierenden‘
Absichten
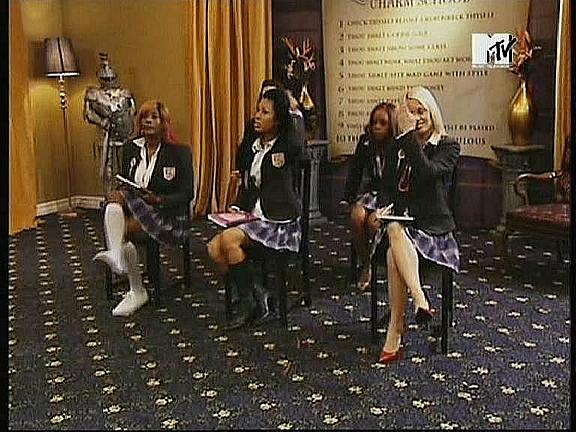
Eine dieser ‚Schülerinnen‘
gab ‚an‘, bis ‚zu‘. gar nicht ‚gewusst/known‘ zu haben, dass es überhaupt so viele [gemeint: fünf,
anstatt einem einzigen] verschiedene Männertypen gibt.
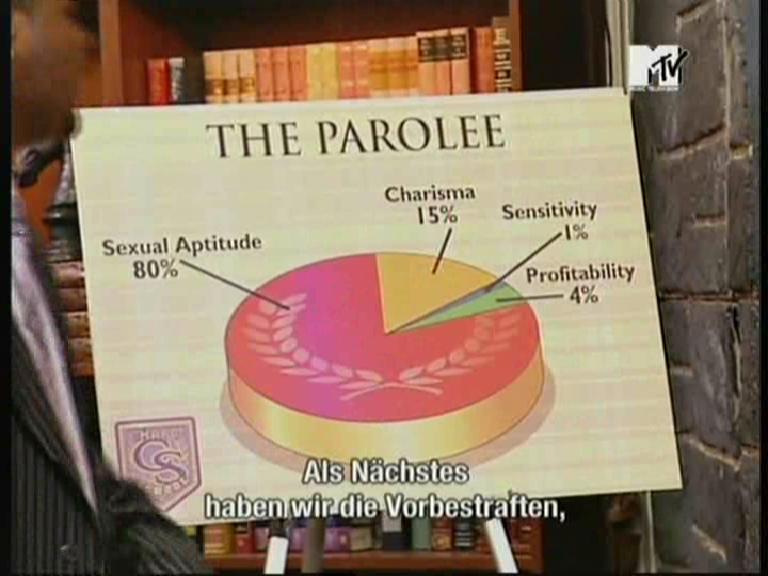
Charm School Flip-Chart :Typ-Vorbestrafter/parolee – Beispiel
besonders unzureichender, popularisiert durchaus (nicht etwa allein, nur in den Vereinigten
Staaten von Amerika) verbreiterter, summenverteilungsparadigmatischer
(entweder-oder-Totalitarismus-)Vorstellungen über/von, zumal verbrecherische, Männer/n; insbesondere was
deren sehr scheintabuaufgeladene Sexualität, im Unterschied zu sonstigen (ohnehin fragwürdigst ausgewählten und allenfalls
karikierend stereotyp quantifiziert aussehenden – anstatt etwa empirisch
umfassender als diese vier vorgegeben Sprachkategorien systematisch denkend zu
fassen vermögen, erhobenen) Eigenschaften angeht.
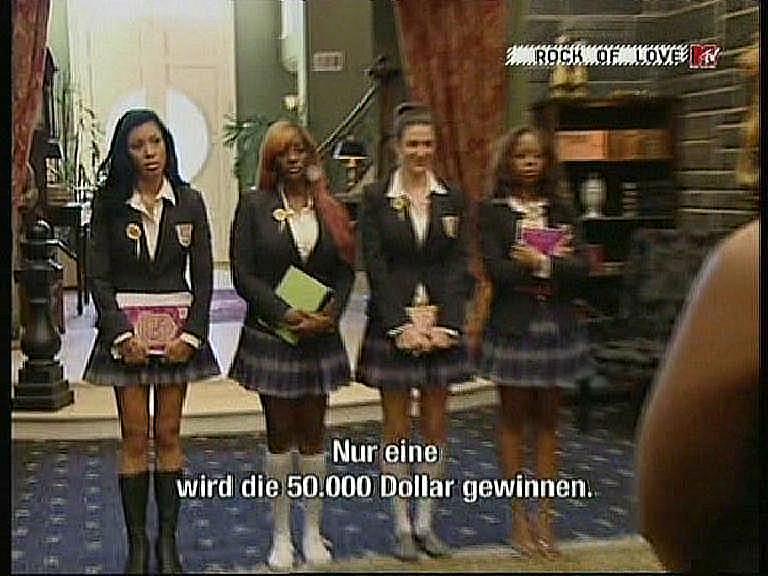
Bevor die dramaturgisch so
ausgewählten, insbesondere monetär konkurrierend angereizten,
und derart belehrten, Menschentöchter, erwartbar an der inszenierten Charm-School
Aufgabenstellung scheiterten, den einzigen, ihnen vorgegebenen Traumtypen,
urban renaisance man mit/im/als/zum Gleichgewicht der vier verwendeten
Eigenschaften (normiert/idealisiert/stilisiert),
unter/aus den Bewerbern aller fünf Typen auf dem abendlichen Ball mit
Männerüberschuss herauszufinden.
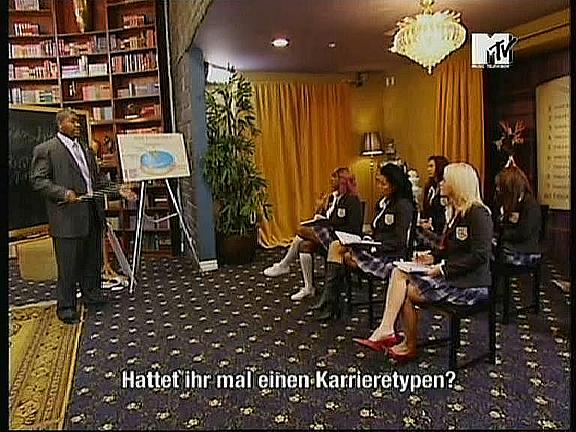 Kontrastklar schulend fragt/e der Herr Lehrer die aufmerksamen Damen brav/systematisch
ab: ‚Hatten Sie mal einen Karrieretypen?
Etc. …‘
Kontrastklar schulend fragt/e der Herr Lehrer die aufmerksamen Damen brav/systematisch
ab: ‚Hatten Sie mal einen Karrieretypen?
Etc. …‘
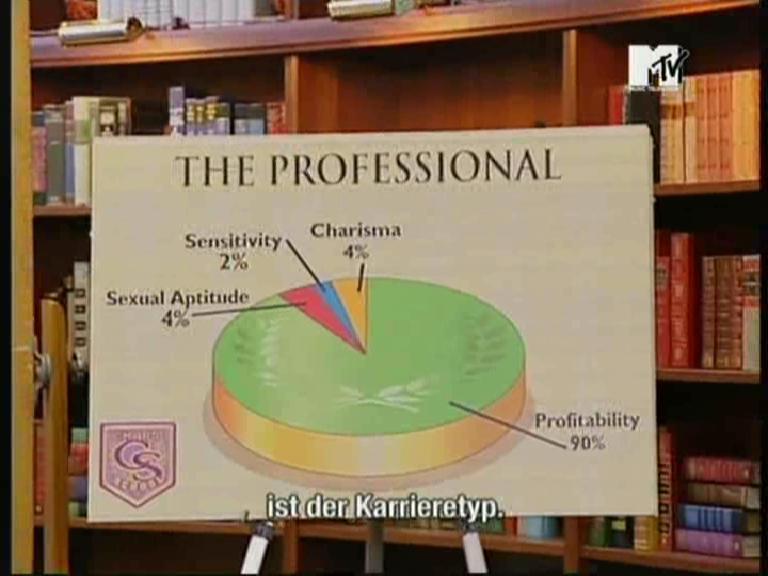
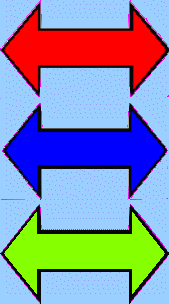
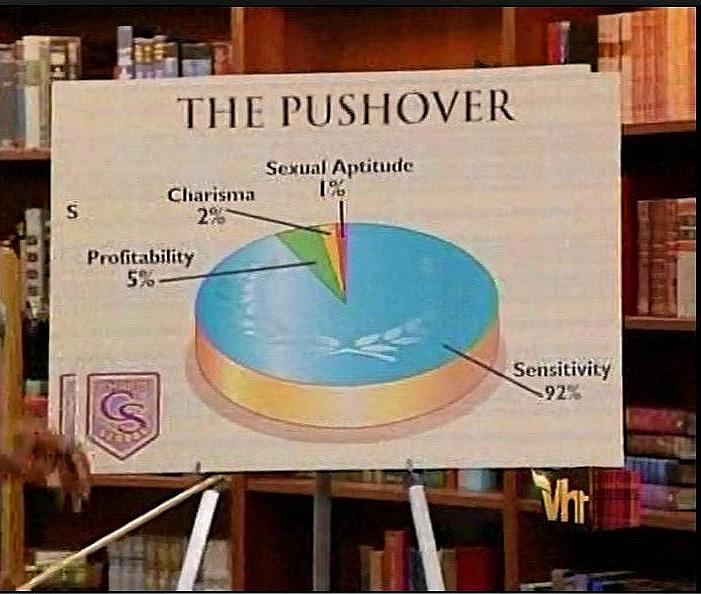
Handlungsdimensionen der/von ‚Unterwerfung
und Herrschaft‘ darunter, wie insbesondere Dominanz/en
versus Submisivität/en könnten ‚sich‘ – zumal bis zumindest ‚mikrokosmisch‘ aktuell auf einzelne, beobachtbare Behavioreme/‚Verhaltenselemente‘,
wie weit auch immer darüber, reduziert[!] – durchaus eher als
– aber eben wechselseitig –entschiedene (zweiwertige entweder-oder) Dichotomien des Dualismus
eignen (als die
ganzen, etwa charakzerlichen Tauglichkeiten und
Eignungen bis rüber Notwendigkeiten, oder gar die jeweiligen Begrifflichkeiten der Vorstellungshorizonte und Deutungssphären).
Zumal die Sehnsüchte und Erfordernisse:
Sich (Jemandem bis [gar Ersatzweise] Jemanden [Anderes?], zumindest aber Etwas – namentlich
einem Denken, Empfinden pp.) zu unterwerfen, situativen und sogar
überzeitlichen Wandel erfahren
(lassen können).
Gerade all die, zumal didaktisch so häufig zumindest unbeliebten/unklar erscheienden,
Dritten ‚neben‘, ‚hinter‘ und ‚über‘, wenigstens aber ‚zwischen‘, entweder als
‚aktiv‘ oder als ‚passiv‘ bezeichneten bis
‚rein‘ verlangten, längst nicht etwa
allein verbalen Geschlechter von Sprachen (vgl. insbesonder soclhe die auch ein neutrales Genus verbi
verwenden; D.C.), sind charakteristisch graue bis bunte
Eigenschaften jedenfalls des und der Menschen.
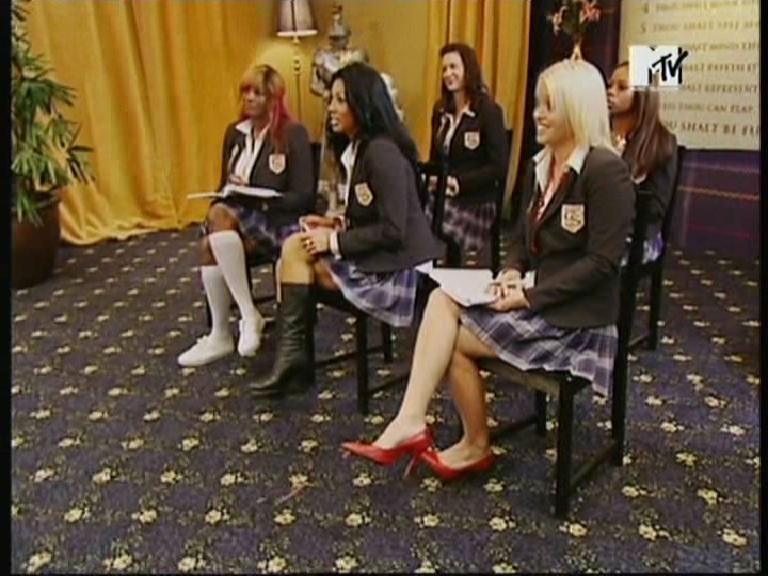
Auch und sogar
gerade ‚Männer‘ sind ja weder so simpel (wie unsere/die
sie repräsentierenden Denkformen und
Vorstellungskategorien/Erfahrungsreichweitenfirmamente),
noch bewährt sich der Menschen dementsprechende Einteilung
tür alle Persönlichkeiten,
respektive nicht in allen ‚Fällen‘.
«Ich glaube [sic! Im Sinne von ‚vermute‘ / ‚erwarte‘ bis
‚unterstelle‘ / ‚behaupte‘], dass man sich über seine eigene Intuition klarer werden kann. Und das geht nur
in Auseinanldersetzung
mit sich selber [Wobei gerade die Betrachtung der Verhaltens- und Intuitionsmuster
anderer Leute nicht hinderlich sein muss, solange/wo sie nicht allein als Vorwand/Vorwirf
dient, selbst nicht-so zu sein/werden zu müssen;
O.G.J.].
Also wenn ich ein Mensch bin, der immer gerne
beliebt sein möchte, dann werden meine intuitiven Handlungen, die ich
vollziehe, aus meiner Erfagrung heraus, sich meistens in diesem Muster bewegen.
Das heißt, ich werde intuitiv Handlungen vollziehen, die [nach dem Wirkprinzip der sich (genaugenommen
nur scheinbar) von selbst erfüllenden Profezeihungen; P.W.]
das Ergebnis haben, dass ich von den anderen wieder geliebt werde.
Wenn ich ein Mensch bin, der eher auf Macht aus
ist, dann werd ich meine intuitiven Entscheidungen eher an diesem Muster
orientieren.
Und ich glaub [sic!], was man lernen kann ist,
dieses Muster zu erkennen, an dem [sich] meine
eigene Intuition [vgl.
G.P.'s Aktenlage auf dem Schreibtisch unseres inneren Archivars]
entlang handelt. Also etwas über mich zu erfahren, über meinen Resonanzboden,
auf dem jede Intuition wächst. Und das ist eine Form von Selbsterkennis, die
mir helfen kann: Weil ich ja vielleicht diesem
Muster nicht mein Leben lang folgen möchte; und damit meine Intuitionen ein
Stück weit steuern kann.» (Reiner Linde; verlinkende Hervorhenungen O.G.J.)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zudem ist/bleibt und wird der
Keller gleich nebenan beinahe/eher noch
peinlicher, als die (kränkende
bzw. hinein- bis herausredenwollende Verhaltens-)Erklärung
mit dem / durch den persöblichen Charakter - sprich: die Nichtänderungsfähigkeit oder gar die
Nichtänderungsbereitschaft des selben - da der
so wertvolle Gründeleller auch und gerade dem ‚ganzen Verstand‘ droben, die besonders
auch drinnen in und von Vernunften
unaufgehobene
Widersprüchlichkeit seiner eigenen Verstandesgründe Wahlentscheidungen
und axiomatische nie-Alternativlosigkeit vorzuenthalten, äh arbeitsteilig zu
deligieren bzw. wegzusperren, ermöglicht.
UndװAber - zumal falls nzw. wo Sie/Euer
Gnaden, oder sonst wer, eine Anklage wider jemanden/sich, bis
gar nach Verbesserung oder Heilung, suchen –
die (![]() zunächst F-)Skla (genannte, sozialpsycho-logische
‚Frankfurter‘
Erhebungsmethode) zur
zunächst F-)Skla (genannte, sozialpsycho-logische
‚Frankfurter‘
Erhebungsmethode) zur ![]() Beschreibung
(nicht allein/erst von so benachbart
‚extrem-fundamentalen'‘ Vorgängen, wie etwa bei bestimmten Gruppen-‚Experimenten‘ zur/der Aufhebung von emphatischen, rechtlichen, ethischen, gar
zivilisatorischer pp. Hemmschwellen - eben
nicht allein abgebrochenen im ‚Labor‘ des Stanford
'prison') bis vergleichenden,
immerhin demoskopischen, Messung: Wie
Beschreibung
(nicht allein/erst von so benachbart
‚extrem-fundamentalen'‘ Vorgängen, wie etwa bei bestimmten Gruppen-‚Experimenten‘ zur/der Aufhebung von emphatischen, rechtlichen, ethischen, gar
zivilisatorischer pp. Hemmschwellen - eben
nicht allein abgebrochenen im ‚Labor‘ des Stanford
'prison') bis vergleichenden,
immerhin demoskopischen, Messung: Wie
![]() autoritär sich ‚eine‘ soziale, bis individuelle, Person/Persönlichkeit verhält,
oder gerade denkt – ‚illustriert‘ / operationalisiert (benannt also konkret
trennend und systematisch/wissenschaftlich untersuchend)
wichtige Aspekte / Auswirlungen von (so gerene verwechselte und etwa zwischen Ebenen bzw.
Seiten vermischte Polaritäten, sich wechselseitig ja durchaus interveri erend
überlappender / durchdringender Sphären wie):
autoritär sich ‚eine‘ soziale, bis individuelle, Person/Persönlichkeit verhält,
oder gerade denkt – ‚illustriert‘ / operationalisiert (benannt also konkret
trennend und systematisch/wissenschaftlich untersuchend)
wichtige Aspekte / Auswirlungen von (so gerene verwechselte und etwa zwischen Ebenen bzw.
Seiten vermischte Polaritäten, sich wechselseitig ja durchaus interveri erend
überlappender / durchdringender Sphären wie):
![]()
![]() Mehr oder minder viel
Reiz- bzw. Affizierbarkeit, bis Betroffenheit, des/der Menschen versus Ablenkungstolleranz, oder gar Irritierungsimunität,
zumal durch/von/gegen immerhin unerwünschte/n,
oder sogar unerwartete/n, Ereignissen / Meinungen
/ Verhaltensweisen (zumal anderer oder 'wichtiger' Leute).
- Reizbarkeit(en) / Wahrnehmungsfähigkeiten
gehören bekanntlich immerhin zu den Voraussetzungen
naturwissenschaftlicher Lebensdefinition, deren - sebst und zumal
auch kontemplative - Aufhebung ja so
gerne mit selektierenden Issolierungs-
bis Tötungsentscheidungen ‚verwechselt‘
(bis nebenan
zu begründen oder gar gleich zu rechtfertigen
versucht bzw. ausgeführt)
werden. Aber auch die Bereitschaft, bzw. Versuchung, sich jederzeit / sofort – insbesondere von Widerständen
– nicht etwa nur/immerhin an der vorgesehenen Art und Weise der, noch weiter drüben öieber
‚Durchführung‘ genannten, Durchsetzung eines (bestimmten, bis erst recht jeden) Vorhabens
hindern zu lassen, gilt daher bekanntlich als (über)lebensuntüchtig –
so dass droben nebenan insbesondere die Tugend der Treue ausgerechnet zur Zielerreichung (respektive das, bis alles – ggf. etwa namentlich, bis auf Vertrags- oder gar Beziehungstreue - was dafür gehalten wird) hohes Ansehen
genießt/reklamiert, äh gleich verabsolutierbare Notwendigkeit
sei.
Mehr oder minder viel
Reiz- bzw. Affizierbarkeit, bis Betroffenheit, des/der Menschen versus Ablenkungstolleranz, oder gar Irritierungsimunität,
zumal durch/von/gegen immerhin unerwünschte/n,
oder sogar unerwartete/n, Ereignissen / Meinungen
/ Verhaltensweisen (zumal anderer oder 'wichtiger' Leute).
- Reizbarkeit(en) / Wahrnehmungsfähigkeiten
gehören bekanntlich immerhin zu den Voraussetzungen
naturwissenschaftlicher Lebensdefinition, deren - sebst und zumal
auch kontemplative - Aufhebung ja so
gerne mit selektierenden Issolierungs-
bis Tötungsentscheidungen ‚verwechselt‘
(bis nebenan
zu begründen oder gar gleich zu rechtfertigen
versucht bzw. ausgeführt)
werden. Aber auch die Bereitschaft, bzw. Versuchung, sich jederzeit / sofort – insbesondere von Widerständen
– nicht etwa nur/immerhin an der vorgesehenen Art und Weise der, noch weiter drüben öieber
‚Durchführung‘ genannten, Durchsetzung eines (bestimmten, bis erst recht jeden) Vorhabens
hindern zu lassen, gilt daher bekanntlich als (über)lebensuntüchtig –
so dass droben nebenan insbesondere die Tugend der Treue ausgerechnet zur Zielerreichung (respektive das, bis alles – ggf. etwa namentlich, bis auf Vertrags- oder gar Beziehungstreue - was dafür gehalten wird) hohes Ansehen
genießt/reklamiert, äh gleich verabsolutierbare Notwendigkeit
sei.
![]() Mehr oder weniger strikte Geschlossenheit
persönlicher Überzeugtheiten, bis Treue dazu, versus
Fähigkeit/Bereitschaft zur (gleich gar, doch nicht allein,
droben reflektierten) Änderung, bis gar Überwindung,
der jeweiligen (eigenen/angeeigneten)
Vorstellungswelt(en) /
Gewissheiten (namentlich über/von 'richtig und falsch').
- Gerade die/autentische Überzeugtheit von (quasis 'ersatzweise' auch bis
eher das, aber kaum weniger leicht manipulierbare als [zumal quantitativ
messend] überprüfbar erscheinende, exakt synchronisierende
Bekenntnis zu – ferner so gerne mit
'ihren'/so mur silbern repräsentierten
Inhalten/Gegenständen vertauschten bis gleichgesetzen) Sätzen
/ Formeln wird, bereits eher zu wenig
bekannter maßen (doch
dafür) treu, als 'Glaube'
missverstanden bis wohlerzogen
bemüht überhöht/vergottet (was eben mit der irrigen Reduzierung / Unterwerfungsversuchen von relationalen
[inner- und zwischen]wesentlichen Beziehungen EMuN/aH ä\ðåîà nebenan unter
inhaltliche/s [gleich gar droben mit Vernunft verwechseltem/n]
Wissen/Kenntnissen
korespondiert).
Mehr oder weniger strikte Geschlossenheit
persönlicher Überzeugtheiten, bis Treue dazu, versus
Fähigkeit/Bereitschaft zur (gleich gar, doch nicht allein,
droben reflektierten) Änderung, bis gar Überwindung,
der jeweiligen (eigenen/angeeigneten)
Vorstellungswelt(en) /
Gewissheiten (namentlich über/von 'richtig und falsch').
- Gerade die/autentische Überzeugtheit von (quasis 'ersatzweise' auch bis
eher das, aber kaum weniger leicht manipulierbare als [zumal quantitativ
messend] überprüfbar erscheinende, exakt synchronisierende
Bekenntnis zu – ferner so gerne mit
'ihren'/so mur silbern repräsentierten
Inhalten/Gegenständen vertauschten bis gleichgesetzen) Sätzen
/ Formeln wird, bereits eher zu wenig
bekannter maßen (doch
dafür) treu, als 'Glaube'
missverstanden bis wohlerzogen
bemüht überhöht/vergottet (was eben mit der irrigen Reduzierung / Unterwerfungsversuchen von relationalen
[inner- und zwischen]wesentlichen Beziehungen EMuN/aH ä\ðåîà nebenan unter
inhaltliche/s [gleich gar droben mit Vernunft verwechseltem/n]
Wissen/Kenntnissen
korespondiert).
![]() Mehr oder minder 'ermüdliche',
gar zivilisiert die eingesetzen
Mittel begrenzende (oder immerhin den vorherrschenden 'Kultur'-Vorstellungen/Regeln ent- bzw. widersprechend totalitäre)
Arten und Weisaen des Umgangs mit (namentlich was Versuche der Einflussnahme angeht auf)
für/als unerwünscht,
unzureichend, oder gar falsch bis gefährlich resoektive verboten gehaltenens / wahrnenommenes Verhalten (nicht notwendigerweise nur oder hauptsächlich
andere Leute): Was (alles) wann
aus Spektren der Motivationsmittel (Legitimieren, in Kenntnis setzen, Anreizen,
Drohen, Santionieren) also wie
handelnd Verwsendung
findet?
Mehr oder minder 'ermüdliche',
gar zivilisiert die eingesetzen
Mittel begrenzende (oder immerhin den vorherrschenden 'Kultur'-Vorstellungen/Regeln ent- bzw. widersprechend totalitäre)
Arten und Weisaen des Umgangs mit (namentlich was Versuche der Einflussnahme angeht auf)
für/als unerwünscht,
unzureichend, oder gar falsch bis gefährlich resoektive verboten gehaltenens / wahrnenommenes Verhalten (nicht notwendigerweise nur oder hauptsächlich
andere Leute): Was (alles) wann
aus Spektren der Motivationsmittel (Legitimieren, in Kenntnis setzen, Anreizen,
Drohen, Santionieren) also wie
handelnd Verwsendung
findet?
![]() Mehr ider minder ausgeprägte verhaltensfaktische Tragfähigkeit, bis gar
zwischenmenschliche Handlungskapazitäten immerhin erweiternde (wechselseitige – etwa asymetrische,
tauschhändlerische, leidenschaftliche pp.) Beziehungsformen (doch insbesondere Kooperationsermöglichungen gegenüber Koexistenzverunmöglichung
bedeutende), bei/trotz/wegen drunten widersprüchlich
fortbestehender / wiederholter - inhaltlich zumal bis immerhin 'denkerischer', aber eben auch was
das Bemnehmen/Verhalten
(immerhin in manchen bis vielen) zumindest je einer Person wichtigen
Hinsichten, angeht - Handlungsweisen.
Mehr ider minder ausgeprägte verhaltensfaktische Tragfähigkeit, bis gar
zwischenmenschliche Handlungskapazitäten immerhin erweiternde (wechselseitige – etwa asymetrische,
tauschhändlerische, leidenschaftliche pp.) Beziehungsformen (doch insbesondere Kooperationsermöglichungen gegenüber Koexistenzverunmöglichung
bedeutende), bei/trotz/wegen drunten widersprüchlich
fortbestehender / wiederholter - inhaltlich zumal bis immerhin 'denkerischer', aber eben auch was
das Bemnehmen/Verhalten
(immerhin in manchen bis vielen) zumindest je einer Person wichtigen
Hinsichten, angeht - Handlungsweisen. ![]() Gerade umgebende
Bildunge hilft eben erheblich
zur Aufrechterhaltung und Tradierung von, aber eben auch bei (immerhin überformenden) Veränderungen
gar aller vorfindlicher charakterlicher Eigenschaften bis Tauglichkeiten.
Gerade umgebende
Bildunge hilft eben erheblich
zur Aufrechterhaltung und Tradierung von, aber eben auch bei (immerhin überformenden) Veränderungen
gar aller vorfindlicher charakterlicher Eigenschaften bis Tauglichkeiten.
Wer
dazu neigt: ‚Versuche/Bedürfnisse des/der Anderen, bis gleich gar gegnerisches, Meinen (bis Aussehen pp.) zuerst/überhaupt (noch) zutreffend verstehen/mit-
bis nachvollziehen (also
zumal nicht notwendigerweise sofort nur als
völlig falsch, bis rein bösartig behandeln), respektive auch/sogar
ein/das ‚Nein‘ höflich entgegenkommend, bis leise, halten, zu s/wollen / können‘, als ‚wetterwendisch beliebige, leichtfertig unernsthaft (gar gegenteilig, gemeinte),
bis dumme/gefährliche, Untreue gegenüber den eigenen, bis heiligen, Prinzipien (des einzig Richtigen und Notwendigen),
Wahrheits-Überzeugungen,
Interessen und/oder Standpunkten‘
zu deuten/empfinden –
muss sich nicht etwa/weiter darüber verwundern:
‚Verhandlungen mit Kompromissen, pausenqualifizierten
Dialog oder gleich jegliche diplomatische
Überzeugungs- oder Ver- und Ausgleichsarbeten,
bis List(en)‘, als
‚betrügerischen Verrat, und/aber sich selbst – äh alle(s) um sich / die (Wir-)Eigengruppe (‚uns‘) her – ‚eigentlich‘
im permanenten Gefechts(bereitschafts)-, bis Kriegszustand‘, zu erleben.
Besonders tief beeindrucken/affizieren
wohl der Charaktere, bis der Persönlichkeiten, Verschiedenheiten
Vielzahlen (des und) der Menschen. – Meinungs- bis sogar
Überzeugungsänderungen,
erst recht durch Verhalten(sanpassungen) qualifiziertes Umsinnen, ‚auch nur/immerhin/dagegen‘ für/als möglich
zu halten/erwarten, folglich … Sie/Euer Gnaden haben/trifft
die Qual der Wahlen.
Neben, bis in (oder ‚durch die‘?), sehr
vielen Möglichkeiten. (droben – ohnehin eher) sich (als etwa andere) zu ändern, darunter
gar auch zu (ver)besseren, respektive (Vorfindliches –
vorzugsweise wohlwollend, anstatt ‚wohlmeinend‘) zu überwinden
(zumal anstatt ‚aufzulösen‘)
– können & dürfen manche Menschen manchmal, zumal
hier, auch so (gar un)vollendet
bleiben (s/wollen), wie etwa Sie/Euer Gnaden (es vielleicht bereits / ‚gemeint‘) sind.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
‚Weiter‘
in Gründekeller des Wehrhauses |
|
Sie haben die Wahl: |
||||||
|
|
|
|||||
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|||||
|
|
Goto project: Terra (sorry still in German) |
|
||||
|
Comments and suggestions are always welcome (at
webmaster@jahreiss-og.de) Kommentare und Anregungen sind jederzeit willkommen (unter: webmaster@jahreiss-og.de) |
|
|||||
|
|
|
|||||
|
|
|
|||||
|
|
|
|
||||
|
|
||||||
|
by
|
||||||